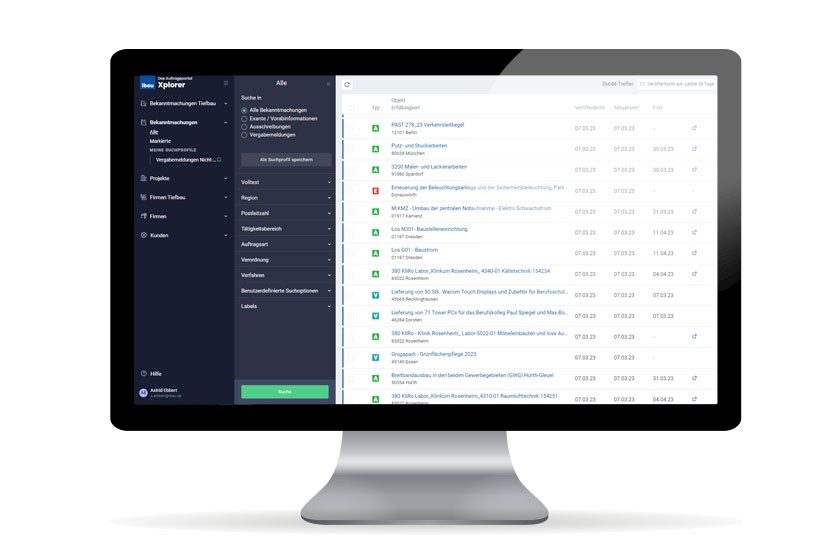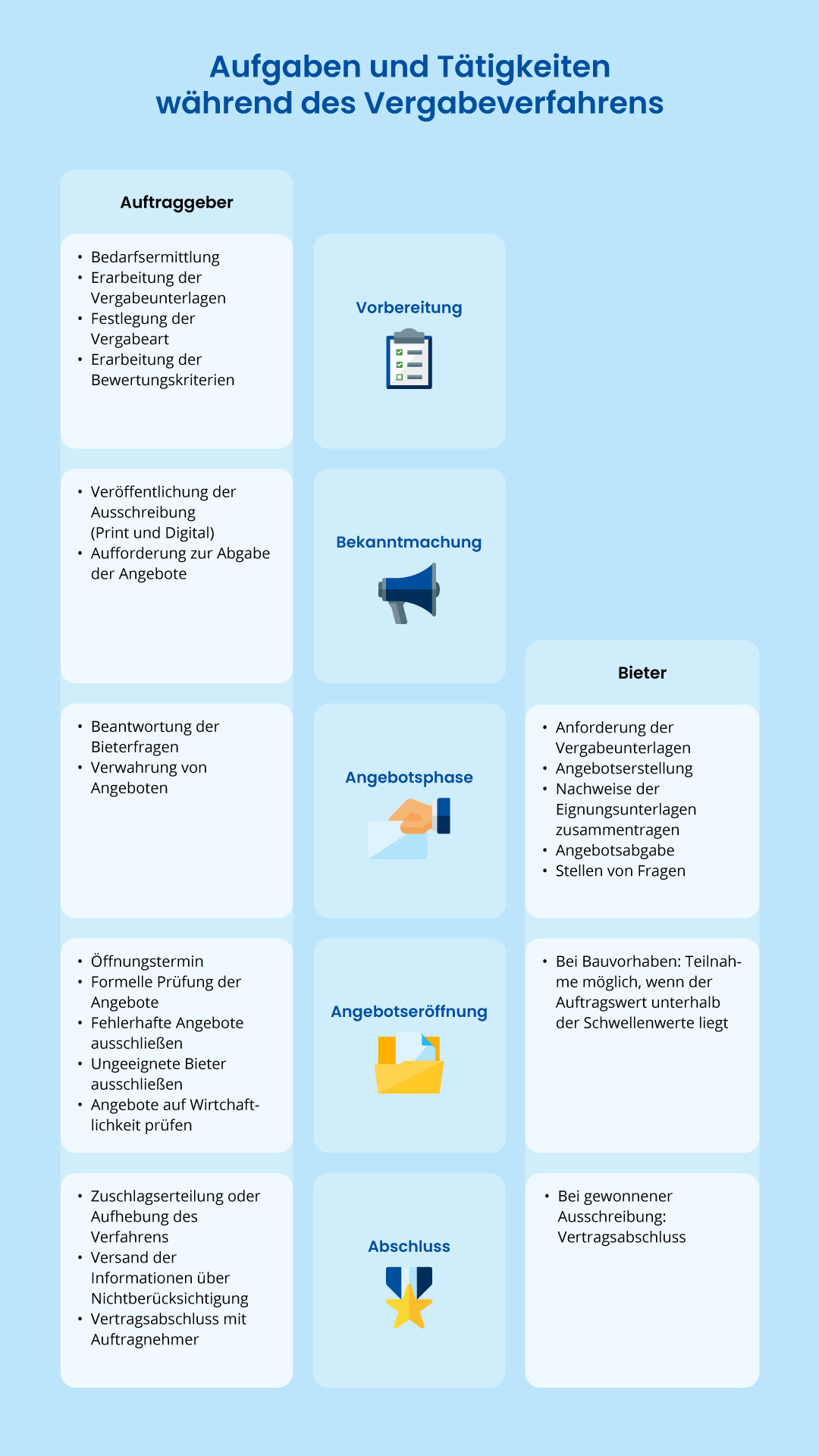Auftraggeber (AG)
Bei einem Auftraggeber / einer Auftraggeberin (AG) handelt es sich um ein Wirtschaftssubjekt, das einer anderen Vertragspartei den Auftrag erteilt, ein bestimmtes Geschäft gegen Entgelt zu erledigen. Diese andere Vertragspartei wird als Auftragnehmer:in (AN) bezeichnet.
Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!
Definition: Was ist ein Auftraggeber?
Umgangssprachlich wird mit dem Begriff "Auftraggeber:in" häufig auf den Bauherren beziehungsweise die Bauherrin verwiesen und bezeichnet die Person, die ein Bauvorhaben in Auftrag gibt. Im kaufmännischen Bereich beziehungsweise bei einem Werkvertrag nach BGB ist von Besteller:in die Rede. In der Rechtswissenschaft ist der Begriff bezeichnend für Mandant:innen, im Bankensegment hingegen für die zahlungspflichtige Person einer Überweisung.
Hinweis: Eine sogenannte Legaldefinition des Begriffs Auftraggeber:in existiert nicht, obwohl er in zahlreichen Gesetzen verwendet wird. Dazu zählen BGB, GWB, MaBV, BNotO, VOB/B und GewO.
Abgrenzung zum Auftragnehmer
Ein:e Auftragnehmer:in hingegen ist die Vertragspartei, die sich dazu verpflichtet, eine Leistung für die andere Partei, in der Regel entgeltlich, zu erbringen. Zwar wird nicht jeder Auftrag mit Geld bezahlt, jedoch ist das in der Praxis die gängigste Variante. Näheres dazu lesen Sie in unserem Glossarartikel zu Auftragnehmern.
Der Auftrag als Grundlage
Die Basis des Auftragsverhältnisses bildet der durch die Auftraggeberseite erteilte Auftrag. Die Auftragnehmerseite muss dann im Interesse des AG tätig werden und ist verpflichtet, sich bei der Ausführung des Auftrags an dessen Weisungen zu halten, sofern diese sich auf das aufgetragene Projekt beziehen.
Erklärung zu Auftraggeber und Käufer: die Abgrenzung
Auftraggeber:in und Käufer:in lassen sich klar voneinander abgrenzen. Verkäufer:innen liefern ein Produkt oder eine Dienstleistung Zug um Zug gegen ein Entgelt des Käufers beziehungsweise der Käuferin. Diesen Geschäften liegt das Kaufrecht zugrunde. Auftraggebende dagegen erhalten die bestellte Leistung nicht zeitlich unmittelbar, sondern erst nach einer gewissen Frist. Die mitunter sehr lange Zeitspanne ergibt sich daraus, dass die Auftragnehmerseite die geforderte Leistung zunächst erstellen muss.
Merkmale einer noch zu erstellenden Leistung
Entweder ist die Leistung nicht lagerfähig, weist auftragsbezogene und damit sehr individuelle Merkmale auf oder birgt ein zu hohes Lagerrisiko. Solchen Auftragsverhältnissen liegen das Werkvertragsrecht, das Werklieferungsvertragsrecht oder das Dienstvertragsrecht zugrunde.
Private und öffentliche Auftraggeber
Es wird grundsätzlich zwischen privaten und öffentlichen Auftraggeber:innen nach § 98 GWB unterschieden.
Der Staat/der Bund, das Land oder die Gemeinden beziehungsweise Städte formen öffentliche Auftraggebende, ebenso wie Verwaltungen, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. Im Sinne des § 99 Nr. 2 GWB zählen jedoch auch andere juristische Personen des öffentlichen Rechts dazu, sofern sie zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen. Ausnahmen bilden hier lediglich Kommunalunternehmen. Auch wenn Kommunalunternehmen oftmals solche Aufgaben erfüllen, die im Allgemeininteresse liegen, muss genau geprüft werden, ob diese tatsächlich nichtgewerblicher Art sind. Auch Unternehmen, die von der öffentlichen Hand betrieben werden, fallen unter den Begriff des öffentlichen AG.
Sie sind für die Vergabe öffentlicher Aufträge verantwortlich, dabei sind sie nach § 99 GWB an die Vorschriften des vierten Teils des GWBs gebunden. Bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen sind Auftraggeber:innen zudem dazu verpflichtet, diese über ein Vergabeverfahren zu vergeben und die VgV (Vergabeverordnung) zu berücksichtigen. Darüber hinaus fallen auch Sektorenauftraggeber:innen nach § 100 GWB und Konzessionsgeber:innen gemäß § 101 GWB in den Anwendungsbereich des Vergaberechts. Mögliche Geschäftsbeziehungen sind Business-to-Administration und umgekehrt sowie Consumer-to-Administration.
Zu den privaten Auftraggebenden zählen zum Beispiel Unternehmen und private Haushalte. Mögliche Geschäftsbeziehungen zwischen AG und AN sind B2C (Business-to-Consumer), C2B (Consumer-to-Business) und B2B (Business-to-Business). Privathaushalte sind zwar im Gegensatz zu öffentlichen Auftraggebenden nicht dazu verpflichtet, die Vorschriften des Vergaberechts anzuwenden, jedoch können sie es freiwillig nutzen.
Zentrale vs. Subzentrale Öffentliche Auftraggeber:innen
Unter zentralen öffentlichen Auftraggebenden versteht man alle obersten Behörden des Bundes und auch seine Verfassungsorgane. Subzentrale Auftraggeber:innen wiederum sind nach der Negativdefinition all solche Einrichtungen, die nicht unter ersteres fallen. Dazu gehören beispielsweise:
- Zuwendungsempfänger:innen
- Mittelbare Bundesverwaltung
- nachgeordnete Behörden des Geschäftsbereichs
Unterschied: privater Auftraggeber und öffentlicher Auftraggeber
Private:r Auftraggeber:in | Öffentliche:r Auftraggeber:in |
|---|---|
|
|
Regelungen des Auftragsrechts
Die gesetzlichen Regelungen zum Auftragsrecht finden sich in den §§ 662 bis 674 BGB. Der oder die Auftragnehmer:in – hier als "Beauftragte:r" bezeichnet – verpflichtet sich bei Auftragsannahme, das Geschäft, das durch die Auftraggeberseite übertragen wurde, unentgeltlich zu besorgen. Die Geschäftsbesorgung darf in der Regel nicht an eine dritte Partei übertragen werden.
Entstehen der Auftragnehmerseite Aufwendungen, kann sie von der Auftraggeberseite Vorschuss verlangen. Auch die entstandenen Aufwendungen müssen ersetzt werden.
Differenzierung zwischen unentgeltlicher und zu vergütender Leistung
Der Begriff "unentgeltlich" lässt zunächst vermuten, dass es sich hier um eine einseitige Gefälligkeit des Auftragnehmers beziehungsweise der Auftragnehmerin handelt. Stattdessen kommt nach § 311 Abs. 1 BGB ein verpflichtender Vertrag zustande. Die Auftraggeberseite ist in einem realistischen Rahmen dazu verpflichtet,
- Auftragnehmer:innen vor vermeidbaren Schäden zu schützen und
- dessen Interessen wahrzunehmen.
Der Geschäftsbesorgungsvertrag
Sobald Auftraggeber:innen und Auftragnehmer:innen eine Vergütung vereinbaren, greift das Recht zum Geschäftsbesorgungsvertrag, das in §§ 611a, 675 Abs.1 oder 631 BGB geregelt ist. Hier wird der oder die Auftragnehmer:in als "Unternehmer:in" bezeichnet. Die vereinbarte Vergütung kann er oder sie erst beanspruchen, wenn die Auftraggeberseite das Werk abgenommen hat.
Auftraggeber: Definition der Leistungsabnahme
Damit die Abnahme als solche anerkannt werden kann, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
- Der oder die Auftraggeber:in nimmt die von der Auftragnehmerseite erbrachte Leistung entgegen.
- Dabei wird der Besitz an die Auftraggeberseite übertragen.
- Die Auftraggeberseite erklärt, dass sie die erbrachte Arbeit als vertragsgemäß anerkennt.
Die Bauabnahme ist in ihrer Definition ähnlich einzustufen. Die Regelungen dazu sind in den jeweiligen Landesbauordnungen fixiert.
Auftraggeberhaftung
Auftraggeber:innen sind für die beauftragten Gewerke in gewisser Weise verantwortlich. So haften Auftraggeber:innen für Hauptauftragnehmer:innen, während Generalunternehmen wiederum für Subunternehmen haften. Prinzipiell ist jeder Betrieb von der Auftraggeberhaftung betroffen, der einen Auftrag an andere weitergibt. Gerade in puncto Schwarzarbeit, Mindestlohn und Sozialversicherungsbeiträge können Auftraggeber:innen haftbar gemacht werden – sie können ihre Ansprüche jedoch an die beauftragten Unternehmen weitergeben.
Um das Haftungsrisiko zu minimieren, sollte sich die Auftraggeberseite die Zahlung des Mindestlohns von dem oder der Hauptauftragnehmer:in schriftlich bestätigen lassen. Bei dem Einsatz eines Generalunternehmens empfiehlt sich ein Vertrag zur Minimierung des Haftungsrisikos mit Prüf- und Kontrollrechten. In solch einem Vertrag ist folgendes festzulegen:
- Regelmäßige Kontrolle der Mindestlohnzahlungen durch Darlegung monatlicher Lohnsummen und geleisteter Arbeitsstunden
- Angaben zu den beauftragten Subunternehmen
- Bestätigung, Subunternehmen zu kontrollieren
- Freistellung des Auftraggebers oder der Auftraggeberin von möglichen Haftungsansprüchen bei Verstößen gegen Mindestlohn
- Außerordentliches Kündigungsrecht bei Verstößen
- Vertragsstrafen, wenn Auftragnehmer:innen den Mindestlohn nicht beziehungsweise nicht rechtzeitig vergüten
Auftraggeberhaftung: Haftung bei Mängeln
In der Regel haften Auftragnehmer:innen bei Baumängeln eines Projekts. Beim Einsatz von Subunternehmen ist in der Regel das Generalunternehmen verantwortlich. In manchen Situationen ändert sich jedoch die Sachlage, sodass die Auftraggeberseite haftet. Das ist in folgenden Situationen der Fall:
- Fehlerhafte Leistungsbeschreibung, Planung oder Anordnung
- Mangelhafte sachliche Voraussetzungen, etwa ungeeigneter Baugrund oder inkorrekte Vorleistungen anderer Gewerke
- Fehler bei der Leistungsüberwachung / Leistungsabnahme
Mithaftung des Auftraggebers
Liegt ein Fehler in der Planung vor, tragen Auftraggeber:innen oft eine Mitschuld. Häufig werden in der Leistungsbeschreibung zahlreiche Punkte genannt, die Auftragnehmer:inmem allein nicht überprüfen können. Beispiel: Einem oder einer Fassadenbauer:in sollte auffallen, wenn in der Leistungsbeschreibung keine Wind- und Schneelasten berücksichtigt wurden. Er oder sie ist jedoch nicht verpflichtet, die gesamte Statik nachzurechnen. Ergo, Auftragnehmer:innen sind lediglich dazu verpflichtet, die Leistungsbeschreibung im Rahmen der eigenen Fachkenntnisse zu prüfen. In solch einem Fall obliegt der Auftraggeberseite eine Teilschuld. Einzig, wenn die Auftragnehmerseite keine Prüfung vornimmt, haftet diese gänzlich. Ähnlich sieht es bei fehler- beziehungsweise mangelhaften Voraussetzungen aus. So ist der oder die AN verpflichtet, die Vorarbeiten anderer Firmen im Ermessen der eigenen Kenntnisse zu prüfen und zu melden.
Bauüberwachung: Meldepflicht gegenüber dem Auftraggeber
Bauüberwacher:innen sind nicht verpflichtet, die Auftragnehmer:innen auf entstandene Mängel hinzuweisen. Seine beziehungsweise ihre Meldepflicht besteht nur gegenüber der Auftraggeberseite. Jedoch kann der oder die Auftragnehmer:in den Fehler bis zur Fertigstellung der Leistung noch ausbessern. Fällt dem oder der Überwacher:in jedoch ein Mangel nicht auf oder meldet diesen nicht, trägt diese Person ebenfalls eine Teilschuld.
Bedenkenanzeige bei Mängeln verfassen
Generell sind Auftragnehmer:innen bei einem Bauvorhaben haftbar. Selbst, wenn der Mangel durch einen Fehler in den Vorleistungen Dritter oder durch mangelhafte Planung beziehungsweise fehlerhafte Anordnungen der auftraggebenden Partei entsteht. Meldet die Auftragnehmerseite ihre Bedenken aber, kann sie nicht beziehungsweise nur teilweise zur Rechenschaft gezogen werden. Nach § 4 Abs.3 VOB/B ist sie dazu verpflichtet, eine Bedenkenanzeige an die Auftraggeberseite zu richten und darin die zu beanstandenden Mängel zu melden. Zusätzlich ist es sinnvoll, dem oder der zuständigen Architekt:in eine Durchschrift zukommen zu lassen.
Die Bedenkenanzeige ist nur gültig, wenn der Zugang nachweisbar erfolgt ist. Wurde keine Bedenkenanzeige verfasst beziehungsweise kann der Zugang nicht belegt werden, ist der oder die AN nach § 13 Abs.5-7 VOB/B weiterhin haftbar.
Auftraggeber finden
Suchen Generalunternehmen nach einem oder einer Auftraggeber:in, werden sie im Internet fündig. Städte und Kommunen schreiben beispielsweise ihre Projekte auf ihren Internetseiten aus; gleiches gilt für andere öffentliche Einrichtungen.
Alternativ bieten Ausschreibungsdatenbanken eine große Sammlung an Ausschreibungen. Auf ibau finden Sie beispielsweise Ausschreibungen für den Hochbau sowie Dienstleistungsaufträge. Zusätzlich bieten praktische Ratgeber Hilfe bei der Suche nach neuen Aufträgen.