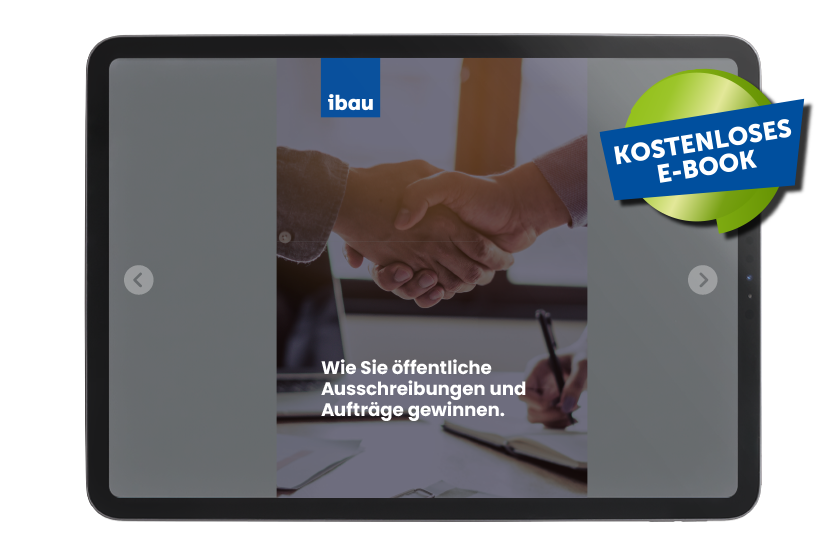Ausschluss wegen Schlechtleistung
Wer einen Auftrag schlecht ausführt, wird beim nächsten Mal nicht wieder engagiert – so ist das in der Privatwirtschaft. Bei öffentlichen Aufträgen gilt im Prinzip dasselbe, doch es gibt Fallstricke.
Das Wichtigste zum Ausschluss wegen Schlechtleistung in Kürze
- Schlechtleistung = nicht vertragsgemäße Erfüllung (auch Nebenpflichten); mindere Qualität oder Nichterbringung
- Rechtsgrundlage: § 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB erlaubt Ausschluss, wenn frühere erhebliche/fortlaufende Mängel zu Kündigung, Rücktritt oder Schadensersatz führten
- Erheblichkeit: Gerichte unterschiedlich streng; belastet der Mangel tatsächlich oder finanziell (OLG Düsseldorf) – teils beides gefordert (OLG Celle)
- Vor Ausschluss zwingend Anhörung und Verhältnismäßigkeitsprüfung; Möglichkeit der Selbstreinigung nach § 125 GWB (Frist max. 3 Jahre, verkürzbar)
- Entscheidung ist Ermessenssache; Ausschluss nur wirksam ohne Ermessensausfall, -überschreitung oder -fehlgebrauch
- Rechtsschutz: Nachprüfungsverfahren oberhalb EU-Schwellenwerten; im Unterschwellenbereich nur in SN, TH, ST möglich; Auftraggeber müssen Mängel und Prognose sauber dokumentieren

Vergabestellen investieren nicht selten viel Zeit, wenn es um die Vergabe von öffentlichen Aufträgen geht. Da muss in einem Vergabeverfahren erst mal nach einem passenden Unternehmen gesucht werden, und wurde dies schließlich gefunden, ist nicht immer garantiert, dass der Auftrag auch wie besprochen ausgeführt wird. Die erbrachte Leistung ist manchmal sogar so enttäuschend, dass die Verantwortlichen das betreffende Unternehmen nicht mit weiteren Aufträgen beauftragen möchten. Doch dürfen Sie es ohne weiteres von künftigen Vergabeverfahren ausschließen, und wann genau ist eine Leistung eine Schlechtleistung?
Was ist eine Schlechtleistung?
Von einer Schlechtleistung kann gesprochen werden, wenn die erbrachte Leistung qualitativ von der vereinbarten Leistung abweicht oder wenn die Leistung nicht erbracht wird. Dabei muss es nicht um die Hauptpflicht gehen. Auch wenn Nebenpflichten betroffen sind, etwa Hinweis- und Kooperationspflichten, kann es sich um eine Schlechtleistung handeln.
Wann ist ein Ausschluss wegen Schlechtleistung gültig?
Sinn und Zweck eines Vergabeverfahrens ist es, öffentliche Belange wie Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen zu verwirklichen und gleichzeitig mit den eingesetzten öffentlichen Geldern sparsam umzugehen. Alle Waren, Dienstleistungen und öffentliche Vorhaben sollen möglichst wirtschaftlich beschafft werden. Diesem Grundsatz stehen schlecht erbrachte Leistungen von Auftragnehmenden entgegen. Wenn ein Unternehmen bereits in der Vergangenheit Schlechtleistungen erbracht hat, gefährdet es unter Umständen die Beschaffung, wenn dieses erneut beauftragt wird. Daher ist öffentlichen Auftraggebenden in der Regel daran gelegen, nur mit zuverlässigen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Auf der anderen Seite muss potentiellen Auftragnehmenden auch das Recht eingeräumt werden, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Sie können verlangen, dass ihr Angebot berücksichtigt wird. Durch einen Ausschluss wird ihnen die Teilnahme am Wettbewerb allerdings verwehrt.
Mangelhafte Erfüllung
Um dieses Spannungsfeld gerecht zu gestalten, ist der Ausschluss von der Vergabe gesetzlich geregelt. So enthält das Vergabemodernisierungsgesetz von 2016 eine Rechtsgrundlage dafür, schlecht leistende Unternehmen auszuschließen (§124 Abs.1 Nr.7 GWB). Vergabestellen können unter bestimmten Umständen “schwarzen Schafen” die Teilnahme am Vergabeverfahren verwehren, wenn sie bei einem früheren öffentlichen Auftrag erheblich oder fortlaufend mangelhaft erfüllt haben und dies zu einer Rechtsfolge wie vorzeitiger Beendigung oder Schadensersatz geführt hat. Dies kann sich nicht nur auf eine Hauptpflicht, sondern auch auf eine Nebenpflicht beziehen. Zu den Nebenpflichten können beispielsweise die Bauförderungspflicht nach der VOB/B gehören oder die vertragliche Rücksichtnahmepflicht.
Ein Mangel ist immer dann gegeben, wenn eine Leistung nicht vertragsgemäß erbracht wurde. Doch ab wann ist dieser Mangel erheblich? Dies geht aus dem Vergaberecht nicht eindeutig hervor und beschäftigte deshalb die Gerichte. Das OLG Celle kam zu dem Schluss, dass ein Mangel dann erheblich ist, wenn der öffentliche Auftraggebende durch den Mangel in tatsächlicher und gleichzeitig auch in finanzieller Hinsicht deutlich belastet wird (OLG Celle, 09.01.2017, 13 Verg 9/16). Nach Ansicht des OLG Düsseldorf hingegen muss nicht beides zugleich gegeben sein. Es reicht, wenn es eine tatsächliche oder eine finanzielle Belastung gibt OLG Düsseldorf, 11.07.2018, VII-Verg 7/18). Typischerweise sind erhebliche Mängel eine Nichterbringung der Lieferung oder der Leistungen oder aber eine mindere Qualität.
Muss es eine Kündigung gegeben haben?
Es reicht allerdings nicht, wenn Auftragnehmende in der Vergangenheit mangelhaft erfüllt haben, um sie von künftigen Vergaben ausschließen zu können. Voraussetzung ist, dass die damaligen Auftraggebenden gegen den Mangel vorgegangen sind und dass daraus eine Rechtsfolge für die auftragnehmende Seite resultierte. Bei dieser Rechtsfolge kann es sich um eine Kündigung handeln, also um eine vorzeitige Beendigung des Vertrages. Aber auch eine Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz, eine Anfechtung des Vertrages oder ein Rücktritt können Vergabestellen dazu berechtigen, diese Unternehmen vom Vergabeverfahren auszuschließen.
Eine Anhörung muss sein
Selbst wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit nachweislich schlecht gearbeitet hat, kann es aufgrund dessen nicht immer problemlos von der Vergabe ausgeschlossen werden. Laut § 124 Abs.1 GWB dürfen Öffentliche Auftraggebende dies nur dann, wenn sie hierbei den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. Hierzu gehört auch, dass vorab eine Anhörung stattgefunden hat. Dem betreffenden Unternehmen soll die Möglichkeit gegeben werden, auf die Vorwürfe reagieren und diese gegebenenfalls widerlegen zu können. Es kann auch Selbstreinigungsmaßnahmen nach § 125 GWB vorschlagen, um den Mangel zu beheben, so die Information des Bundeskartellamtes.
Vergabestellen sollten vor dem Ausschluss wegen Schlechtleistung zwingend eine Anhörung durchführen, weil sie diese nicht nachholen können. Dies ist im Rahmen des Nachprüfungsverfahren nämlich nicht möglich.
Ausschluss wegen Schlechtleistung: eine Ermessensentscheidung
Enttäuscht eine Auftragnehmerin oder ein Auftragnehmer die Erwartungen des Auftraggebenden und handelt es sich tatsächlich um eine Schlechtleistung, liegt es im Ermessen des öffentlichen Auftraggebenden, ob sie das betreffende Unternehmen von künftigen Vergaben ausschließen wollen. Das heißt jedoch nicht, dass dies ohne weiteres möglich ist. Die Entscheidung muss ermessensfehlerfrei sein.
Die folgenden Ermessensfehler verhindern einen Ausschluss wegen Schlechtleistung:
- Ermessensausfall
- Das Ermessen wurde nicht ausgeübt.
- Ermessensüberschreitung
- Das Ermessen wurde über den gesetzten Rahmen hinaus ausgeübt und verletzt die Rechte der Gegenseite
- Ermessensfehlgebrauch
- Die Ermessensentscheidung beruht auf fehlerhaften Annahmen.
Schutzmaßnahmen gegen Ausschluss wegen Schlechtleistung
Auf der anderen Seite müssen die Auftragnehmer:innen davor geschützt werden, möglicherweise ungerechtfertigt von Vergaben ausgeschlossen zu werden. Fühlt sich die auftragnehmende Seite zu Unrecht von einer Vergabe ausgeschlossen, kann sie dagegen vorgehen.
Nachprüfungsverfahren
Bewegt sich die Vergabe oberhalb der Schwellenwerte, können vom Verfahren ausgeschlossene Bieterinnen und Bieter ein Nachprüfungsverfahren anstrengen. Hierbei müssen sie sich an die Vergabekammern wenden. Bei Vergaben im Unterschwellenbereich ist das anders. In den meisten Bundesländern haben betroffene Unternehmen keine Möglichkeit, ein Nachprüfungsverfahren durchführen zu lassen. Nur in Sachsen, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt ist dies möglich.
Selbstreinigung
Wenn ein Unternehmen von künftigen Vergabeverfahren ausgeschlossen wurde, gilt dies höchstens für drei Jahre ab dem Zeitpunkt des Ereignisses, das zum Ausschluss geführt hat. Doch betroffene Unternehmen können diese Frist verkürzen, indem sie eine Selbstreinigung gemäß § 125 GWB vornehmen. Sie können beispielsweise einen durch ihr Fehlverhalten verursachten Schaden wieder gut machen oder einen Ausgleich zahlen.
Was bedeutet das für Bieter:innen?
Bieterinnen und Bieter können sich darüber freuen, dass der §124 Abs. 1 Nr. 7 GWB den Vergabestellen ein paar Hürden in den Weg legt, was den Ausschluss bei Schlechtleistung betrifft. Sollte eine Vergabestelle versuchen, sie vom Vergabeverfahren auszuschließen, lohnt es sich dagegen vorzugehen. Hierfür stehen Bieterinnen und Bieter als rechtliche Mittel eine Rüge oder ein Nachprüfungsantrag zur Verfügung.
Welche Konsequenzen hat das für die Auftraggeber:innen?
Der §124 Abs. 1 Nr. 7 GWB verschafft Bieterinnen und Bietern die Möglichkeit, sich vor schwarzen Schafen zu schützen. Dadurch soll auch sichergestellt werden, dass öffentliche Gelder wirtschaftlich eingesetzt werden. Doch für Vergabestellen ist ein Ausschluss mit einem gewissen Aufwand verbunden, denn die Hürden hierfür sind hoch. Sie müssen die Schlechtleistung dokumentieren und anhand dessen eine Prognose über künftige Schlechtleistungen abgeben. Diese Prognose muss aber gut begründet und in der Vergabeakte dokumentiert werden. Hinzu kommt, dass die Vergabestellen das ihnen zustehende Ermessen rechtsfehlerfrei ausüben müssen. Mögliche Rechtsfehler können sachfremde Erwägungen sein, oder das Übersehen von wesentlichen Details.
Gratis E-Book: Bewerben Sie sich erfolgreich, um Ihre Auftragschancen zu erhöhen