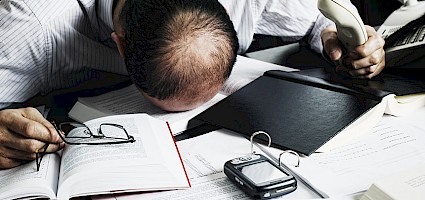Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen
Die Klimarahmenkonvention ist ein globales Umweltabkommen. Es wurde im Jahr 1992 von 197 Vertragsparteien unterzeichnet und trat 1994 in Kraft.
Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!
Was ist die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen?
Die Klimarahmenkonvention – auf englisch United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) – wird als völkerrechtliche Basis für den globalen Klimaschutz angesehen. Da insgesamt 197 Vertragsparteien dieses Rahmenübereinkommen unterzeichneten, kann man davon ausgehen, dass die Klimaänderungen als Problem wahrgenommen wurden und die Staaten sich zum Handeln verpflichtet fühlten.
Der Klimaschutz wurde im Rahmen dieses Umweltabkommens als gemeinsame Verantwortlichkeit definiert. Hierbei wurden den verschiedenen Mitgliedstaaten auch verschiedene Verantwortlichkeiten übertragen – je nach der Fähigkeit des jeweiligen Staates. Dabei sollten die entwickelten Staaten eine Führungsrolle übernehmen, während die Entwicklungsländer ihre besonderen Einschränkungen geltend machen konnten.
Was war das Ziel der Klimarahmenkonvention?
Die Klimarahmenkonvention zielte darauf ab, die globale Erwärmung zu verlangsamen. Die Treibhausgaskonzentrationen sollten weder weiter zunehmen noch auf dem damaligen Niveau bleiben, sondern vielmehr auf ein Ausmaß stabilisiert werden, welches das Klimasystem nicht zu stark gefährdet. Es sollten also weniger Treibhausgase in die Umwelt geraten. Alle 197 Unterzeichnerstaaten dieses Rahmenübereinkommens erklärten sich dazu bereit, zusammenzuarbeiten und gemeinsam den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Dies sollte es den Ökosystemen ermöglichen, sich nach und nach an die Klimaänderungen anzupassen (Artikel 2 UNFCCC).
Was sind die Folgen des Klimawandels?
Die gefährlichen Folgen des Klimawandels sollten durch dieses Umweltabkommen abgemildert werden, insbesondere die folgenden Klimaphänomene:
- Extremwetterereignisse wie Starkregen, Dürren oder Hitzesommer
- Überschwemmungen
- starke kurzfristige Klimaschwankungen
- Verlust der Artenvielfalt
- Waldbrände
- Auswaschung der Ackerböden
- Anstieg des Meeresspiegels
Diese Art des Klimawandels führt zwangsläufig auch zu wirtschaftlichen Problemen und Schwierigkeiten bei der Nahrungsmittelproduktion.
Was wurde bei den Klimarahmenkonventionen beschlossen?
Zum einen verpflichteten sich die Vertragspartner des Rahmenübereinkommens dazu, sich jährlich auf einer Konferenz (UN-Klimakonferenz oder Weltklimagipfel) zu treffen, um sich auf konkrete Maßnahmen zu einigen. Darüber hinaus waren die Mitgliedsstaaten zur Berichterstattung verpflichtet und mussten sogenannte Treibhausgasinventare anfertigen. Sie sollten regelmäßig über die Treibhausgas-Emissionen ihres Staates berichten. Teil der Berichte waren auch die Minderungsmaßnahmen, die sie durchführten, um die Emissionen zu verringern. Es gibt drei unterschiedliche Berichte beziehungsweise Treibhausgasinventare, die regelmäßig angefertigt werden müssen:
- Ein nationaler Inventarbericht (jährlich): Der Bericht enthält die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen.
- Ein Nationalbericht (alle vier Jahre): Auch dieser Bericht bilanziert die Treibhausgasemissionen, enthält aber darüber hinaus noch Informationen über die Maßnahmen zur Treibhausgasreduktion und über den Emissionsrechtehandel des jeweiligen Mitgliedstaats.
- Zweijähriger Bericht: Dieser Bericht muss seit 2014 angefertigt werden. Er fasst die Ergebnisse des Inventarberichts, des Nationalberichts und auch die Ergebnisse anderer Klimaschutzberichte des jeweiligen Mitgliedstaats zusammen und gibt einen kompakten Überblick. Darüber hinaus enthält er eine Prognose darüber, wie die Emissionen in den nächsten Jahren ausfallen könnten. Der zweijährige Bericht wird nicht in der Landessprache, sondern auf Englisch verfasst.
Die UN-Klimakonferenzen
Die wohl bekannteste der jährlich stattfindenden UN-Klimakonferenzen war die Konferenz in Kyoto von 1997. Hier einigten sich die Mitgliedsstaaten auf das sogenannte Kyoto-Protokoll, welches die Industriestaaten zu Treibhausgas-Minderungszielen verpflichtete und den internationalen Emissionshandel einführte. Das Kyoto-Protokoll ist der erste völkerrechtlich verbindliche Vertrag mit dem Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen zu minimieren und auf diese Weise das Klima zu schützen. Es trat 2005 in Kraft und galt bis zum Jahr 2020. Das Kyoto-Protokoll wurde von allen Industrieländern mit Ausnahme der USA ratifiziert.
Auch die UN-Klimakonferenz in Paris (2015) gilt als Meilenstein. Hier wurde das sogenannte Pariser Klimaabkommen abgeschlossen, damit vor allem drei Ziele enthielt:
- Den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur zu beschränken
- Die Emissionen zu senken
- Die Finanzmittel so zu lenken, dass sie mit den Klimaschutzzielen harmonieren
Insgesamt unterzeichneten 195 Staaten das Pariser Klimaabkommen.
Was bedeuten die Klimaziele für das Vergaberecht?
Bei der öffentlichen Vergabe spielen Umweltabkommen insgesamt eine immer größer werdende Rolle. Im Zuge des Trends zur umweltfreundlichen Beschaffung wurde auch die Reduktion von Treibhausgasen zum wichtigen Kriterium. So können Vergabestellen bereits bei der Auswahl des Auftragsgegenstands der CO2-Ausstoß wichtig sein, wie beispielsweise bei der Beschaffung von Bussen. Auch die Leistungsbeschreibungen von zu vergebenden öffentlichen Aufträgen enthalten manchmal Spezifikationen zur Minderung von Treibhausgasen. Außerdem können Vergabestellen in der Eignungsprüfung festlegen, dass Bieter:innen bestimmte Umweltnormen erfüllen. Dies kann natürlich auch den CO2-Ausstoß betreffen. Darüber hinaus kann Klimaschutz auch als Zuschlagskriterium in die Angebotsbewertung einfließen oder in die zusätzlichen Bedingungen für die Ausführung des Auftrags.
Bundesbehörden sind seit dem Inkrafttreten der “Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen” (AVV Klima) im Jahr 2022 dazu verpflichtet, bei der Beschaffung auf klimafreundliche Leistungen zu setzen. Im Rahmen der Vorschrift müssen Vergabestellen alle Treibhausgasemissionen, die für die Herstellung und für den Betrieb eines Produktes anfallen, beachten. Das gilt für den gesamten Lebenszyklus des Produktes.