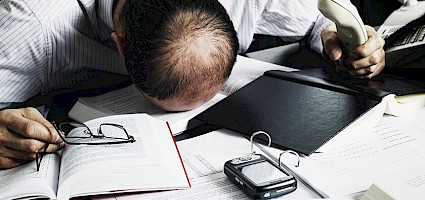Gemeinschaftsrecht
Das Gemeinschaftsrecht ist die Rechtsordnung der Europäischen Union, die sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für Einzelpersonen gilt. Es ist aus aufeinanderfolgenden Änderungen der EU-Verträge hervorgegangen und kann als ein Regelwerk verstanden werden. Heute findet vermehrt der Begriff Unionsrecht seine Anwendung, anstelle des Gemeinschaftsrechts.
Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!
Was ist das Gemeinschaftsrecht?
Die EU besteht aus mehreren Gemeinschaftsmitgliedern, die alle als selbstständige und souveräne Staaten agieren und jeweils eine eigene Verfassung und eine eigene Rechtsetzung haben. Als Mitgliedsstaaten haben sie der Europäischen Union jedoch Hoheitsrechte übertragen, die zur Folge haben, dass das Gemeinschaftsrecht nun Vorrang vor jedem nationalen Recht hat und auch als supranationale Rechtsordnung bezeichnet wird. Die Übertragung der Hoheitsrechte folgt dem Subsidiaritätsprinzip, dem zufolge rechtliche Aspekte dort behandelt werden sollen, wo die Regelung am effizientesten erscheint. Neben dem Anwendungsvorrang zeichnet sich das Unionsrecht auch durch die unmittelbare Anwendbarkeit ohne nationalen Umsetzungsakt aus. Es wird allen Mitgliedern und Gemeinschaftsorganen direkt und verpflichtend auferlegt. Die praktische Wirksamkeit beziehungsweise die Effizienz und der Rechtsschutz einzelner Personen sind Gründe für dieses Unionsrecht. Ein Beispiel ist das deutsche Kartellvergaberecht, welches ebenfalls durch das Gemeinschaftsrecht geprägt ist und die EU-Regelungen für Vergaben im Oberschwellenbereich regelt.
Aufbau des Gemeinschaftsrechts
Das Gemeinschaftsrecht ist stufenförmig aufgebaut und ähnelt somit dem innerstaatlichen Recht. Man unterscheidet zwischen dem Primärrecht und dem Sekundärrecht, was man auf nationaler Ebene mit dem Verfassungsrecht und dem einfachen Recht vergleichen kann.
Das Primärrecht umfasst die Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften, deren Änderungen beziehungsweise Ergänzungen und den Vertrag der Europäischen Union. Darin befinden sich außerdem die allgemeinen Rechtsgrundsätze, wie die Grundrechte, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) verbindlich für alle Mitgliedsstaaten formuliert hat, oder objektiv rechtsstaatliche Prinzipien. Die Verträge der Gemeinschaftsstaaten bilden Vereinbarungen zwischen ihnen ab, die dann als Rechtsakte des Primärrechts Anwendung finden. Gleichzeitig regeln die Verträge auch, welche Organe am Beschlussverfahren teilnehmen und ordnet ihnen die jeweiligen Rollen und Zuständigkeiten zu.
Verlauf der Verträge
Vertrag | Jahr | Die wichtigsten Änderungen |
|---|---|---|
Römische Verträge | 1958 |
|
Änderungen durch die Einheitliche Europäische Akte | 1987 |
|
Änderungen durch den Vertrag von Maastricht | 1993 |
|
Änderungen durch den Vertrag von Amsterdam | 1999 |
|
Änderungen durch den Vertrag von Nizza | 2003 |
|
Ablösung Vertrag von Nizza durch Vertrag von Lissabon | 2009 |
|
Besonders die Einführung des Vertrags von Lissabon hat viele Änderungen im Gemeinschaftsrecht mitgebracht. Darin enthalten sind unter anderem Änderungen zum Vertrag der Europäischen Union und zum Vertrag über die Arbeitsweise der EU.
Das Sekundärrecht
Auf Grundlage des Primärrechts wurde vom Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament schließlich das Sekundärrecht beschlossen. Darunter versteht man erlassene Rechtsakte, die meistens in Form von Verordnungen, Entscheidungen, Richtlinien oder Empfehlungen geltend gemacht werden. Diese Gesetze bauen auf den Verträgen des Primärrechts auf und der Erlass erfolgt durch unterschiedliche Verfahren, die in den Vertragsartikeln festgelegt sind. In dem Vertrag von Lissabon wird zwischen folgenden Instrumenten des Sekundärrechts unterschieden:
- Verordnungen haben eine allgemeine Wirkung, sind in allen Mitgliedstaaten unmittelbar und verbindlich anzuwenden und betreffen die gesamte Gemeinschaft. Die Behörden und Gemeinden müssen den Verordnungen folgen, selbst wenn ein nationales Gesetz dem widerspricht. Außerdem bedarf es keiner nationalen Umsetzung.
- Richtlinien müssen von den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Dabei sind das Ziel und der Zeitrahmen genau festgelegt. Die Mitglieder können jedoch frei zwischen den eingesetzten Mitteln zur Umsetzung wählen.
- Entscheidungen und Beschlüsse sind rechtlich verbindliche Regelungen für bestimmte Einzelfälle. Sie sind direkt an Einzelne oder an einen Mitgliedstaat gerichtet und bedürfen keinen nationalen Umsetzungsmaßnahmen.
- Empfehlungen und Stellungnahmen gelten als Mittel der Meinungsäußerung. Sie haben keine rechtliche Bindungswirkung, sondern sind lediglich ein Versuch der Gemeinschaftsorgane, Einfluss auf die Mitgliedstaaten auszuüben. Die Stellungnahmen enthalten zudem Beurteilungen einer Sachlage
Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht
Im Falle eines Verstoßes gegen das Unionsrecht, kann der Mitgliedstaat vor dem EuGH verklagt werden. Der Europäische Gerichtshof hat veranlasst, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den Schaden, der durch den Verstoß entstanden ist, auszugleichen. Für einen solchen Entschädigungsanspruch müssen jedoch drei Voraussetzungen erfüllt sein:
- Verletzung einer EU-Rechtsnorm, die den Geschädigten hätte schützen sollen.
- Der Verstoß muss hinreichend qualifiziert sein, das heißt, die Grenzen wurden erheblich und offenkundig überschritten.
- Es muss ein unmittelbarer Kausalzusammenhang zwischen Verstoß und Schaden vorliegen.
Die Entschädigung muss eine Höhe annehmen, die den entstandenen Schaden angemessen kompensiert.