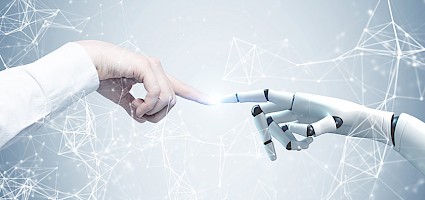Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), kurz Lieferkettengesetz, regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in globalen Lieferketten. Das umfasst beispielsweise den Schutz vor Kinderarbeit, das Recht auf faire Löhne und den Umweltschutz.
Mit ibau finden Sie passende Ausschreibungen & Aufträge: Jetzt Auftragschancen entdecken!
Inhaltsverzeichnis
- Entstehung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
- Die Ziele des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
- Welche Unternehmen betrifft das Sorgfaltspflichtengesetz?
- Wozu verpflichtet das Sorgfaltspflichtenlieferkettengesetz?
- Umsetzung durch Unternehmen
- Was passiert bei Verstößen gegen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz?
- Unterstützungsangebote der Bundesregierung
- Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
- Die Europäische Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD)
Entstehung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
Mit dem Einsturz der Textilfabrik Rala Plaza in Bangladesch im April 2013, bei dem 1135 Menschen starben und 2500 schwer verletzt wurden, wurde die Forderung nach einem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz laut. Der Grundstein für das Gesetz wurde 2016 gelegt, als die Bundesregierung den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) verabschiedet hat, um gemeinsam mit Unternehmen zu einer sozial gerechten Globalisierung beizutragen. Doch danach hat es bis zu der eigentlichen Verabschiedung noch zahlreiche kontroverse Diskussionen gegeben. Im Februar 2021 konnte sich die Bundesregierung nach 62 Verhandlungsrunden auf ein Lieferkettengesetz einigen, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.
Die Ziele des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz soll zur Verbesserung der internationalen Menschenrechtslage beitragen, indem es Anforderungen an ein verantwortungsvolles Management von Lieferketten festlegt. Die Sorgfaltspflichten sind nach der Einflussmöglichkeit der Unternehmen beziehungsweise den Zweigniederlassungen abgestuft.
Welche Unternehmen betrifft das Sorgfaltspflichtengesetz?
Das Gesetz betrifft Unternehmen mit Hauptverwaltung, Hauptniederlassung, Verwaltungssitz, satzungsmäßigem Sitz oder Zweigniederlassung in Deutschland. Seit dem 1. Januar 2023 galt es für Unternehmen mit mindestens 3.000 Beschäftigten. Seit dem 1. Januar 2024 wurde die Grenze auf 1.000 Beschäftigte heruntergesetzt. Kleine Unternehmen sind nur mittelbar durch das Gesetz betroffen, etwa indem sie als Zulieferer für betroffene Unternehmen arbeiten und diese Informationen benötigen. Eine freiwillige Achtung der Sorgfaltspflichten in Anlehnung an das Lieferkettengesetz ist aber mit Blick auf eine potentielle Erweiterung des Geltungsbereiches zu empfehlen.
Wozu verpflichtet das Sorgfaltspflichtenlieferkettengesetz?
Das Gesetz verpflichtet Unternehmen, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in ihrer Lieferkette umzusetzen. Das Kernelement ist die Einrichtung eines Risikomanagements, um die Risiken von Menschenrechtsverletzungen und Schädigungen der Umwelt zu identifizieren, zu vermeiden oder zu minimieren. Darauf basierend müssen Präventions- und Abhilfemaßnahmen beschlossen werden. Zudem müssen ein Beschwerdeverfahren eingerichtet und regelmäßig Berichte an das BAFA übermittelt und veröffentlicht werden. Das Gesetz bezieht sich auf den eigenen Geschäftsbereich, aber auch auf das Handeln der Vertragspartner oder weiterer (mittelbarer) Zulieferer entlang der gesamten Lieferkette.
Die Wirkung des Gesetzes wird 2026 evaluiert. Im Lichte einer möglichen EU-Gesetzgebung wird dann geprüft, ob Anpassungen nötig sind und ob eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf weitere Unternehmen vorgenommen werden soll.
Umsetzung durch Unternehmen
In erster Linie sind Unternehmen aufgefordert, ein angemessenes und wirksames Risikomanagement zu etablieren, das in allen maßgeblichen Geschäftsabläufen integriert ist. Wirksam ist es dann, wenn menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken erkannt, Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen und sie daraufhin minimiert oder beendet werden. Die Sorgfaltspflichten evozieren folgende Maßnahmen:
- Einrichtung eines Risikomanagements
- Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit
- Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen
- Abgabe einer Grundsatzerklärung
- Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, gegenüber unmittelbaren Zulieferern sowie bei mittelbaren Zulieferern, insofern es Anhaltspunkte für mögliche Verletzungen gibt
- Ergreifen von Abhilfemaßnahmen
- Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens
- Dokumentation und Berichterstattung
Risikoermittlung
Vor Beginn der eigentlichen Risikoermittlung müssen die Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisation festgelegt werden, etwa durch die Benennung eines oder mehrerer Menschenrechtsbeauftragte. Diese haben dann als ersten Schritt eine Risikoanalyse zu erstellen. Die Analyse soll Transparenz schaffen und die Teile der Produktions- und Lieferkette identifizieren, die besonders hohe menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken bergen, dazu zählen auch die Geschäftsbereiche der Zulieferer.
Risikominimierung
Wenn bekannt ist, wo Risiken bestehen, gilt es, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass mit Zulieferern entsprechende Menschenrechtsklauseln vertraglich vereinbart, geeignete Beschaffungsstrategien oder Kontrollmaßnahmen implementiert oder Schulungen angeboten werden. Wenn festgestellt wurde, dass es bereits zu Menschenrechtsverletzungen gekommen ist, müssen Maßnahmen zur Beendigung oder Minimierung ergriffen werden. Menschenrechtsverletzungen bei mittelbaren Zulieferern müssen analysiert, beachtet und angegangen werden, wenn Unternehmen Anhaltspunkte für mögliche Menschenrechtsverletzungen haben.
Beschwerdemöglichkeiten etablieren
Unmittelbar Betroffenen sowie denjenigen, die Kenntnis über potentielle oder tatsächliche Verletzungen haben, muss es ermöglicht werden, ein Unternehmen auf Risiken und Verletzungen hinzuweisen.
Verantwortung anerkennen und Grundsatzerklärung abgeben
Unternehmen sind dazu verpflichtet, eine Grundsatzerklärung über ihre Menschenrechtsstrategie abzugeben. Darin müssen die im Rahmen der Risikoanalyse festgestellten und prioritären Risiken benannt werden, ebenso wie die abgeleiteten Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Auch das Beschwerdeverfahren muss erläutert werden sowie die Erwartungen an die eigenen Beschäftigten sowie Lieferanten. Die Erklärung muss durch die Unternehmensleitung verabschiedet werden.
Berichterstattung
Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist unternehmensintern fortlaufend zu dokumentieren. Zudem muss dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) jährlich ein Bericht vorgelegt werden. Dieser hat Auskunft darüber zu geben…
- ob und welche menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken das Unternehmen identifiziert hat.
- was das Unternehmen zur Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten unternommen hat.
- wie das Unternehmen die Auswirkungen und die Wirksamkeit seiner Maßnahmen bewertet.
- welche Schlussfolgerung es für künftige Maßnahmen zieht.
Der Bericht muss spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres beim BAFA eingereicht und auf der Unternehmenswebseite öffentlich einsehbar gemacht werden. Dort muss er sieben Jahre lang verfügbar sein. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind dabei selbstverständlich geschützt. Aktuell wird an einem elektronischen Berichtsformat gearbeitet, um den Aufwand für Unternehmen möglichst gering zu halten. Zudem können die gemacht Angaben auch zur Erfüllung der CSR-Berichtspflicht verwendet werden.
Was passiert bei Verstößen gegen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz?
Bei Missachtung drohen Bußgelder von bis zu 8 Millionen Euro oder zwei Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Der umsatzbezogene Bußgeldrahmen gilt nur für Unternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro Jahresumsatz. Bei einem verhängten Bußgeld ist es ab einer bestimmten Höhe möglich, von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen zu werden.
Unterstützungsangebote der Bundesregierung
Die Ermittlung und Vermeidung menschenrechtlicher Risiken entlang der Lieferkette ist ein komplexes Thema. Um dabei zu helfen, hat die Bundesregierung verschiedene Unterstützungsangebote eingerichtet. Wenn Sie eine konkrete Frage haben, kann es sein, dass diese bereits im Rahmen der umfangreichen Frage und Antwort sowie Best-Practive-Beispiele zum Lieferkettengesetz beantwortet wurde. Zudem stehen verschiedene Handreichungen, etwa zum Prinzip der Angemessenheit, der Einrichtung eines Beschwerdeverfahren oder zur Zusammenarbeit in der Lieferkette, zur Verfügung. Das BAFA hat zudem eine Handreichung zur Umsetzung der Risikoanalyse erstellt, die die wichtigsten Informationen zusammenfasst und praktische Umsetzungmöglichkeiten aufzeigt.
Länderspezifische Informationen stellt Germany Trade & Invest gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt und der Deutschen Industrie- und Handelskammer zur Verfügung. Hier wird über potenzielle Risiken, gesetzliche Grundlagen sowie Präventions- und Abhilfemaßnahmen aufklären.
Das zentrale Beratungsangebot der Bundesregierung ist der Helpdesk Wirtschaft & Menschenrechte (WiMR). Unternehmen jeder Größe können dort eine persönliche Beratung erhalten, sei es eine telefonische oder schriftliche Ad hoc Beratung oder ein langes Planungsgespräch in persona. Es wenden sich auch immer mehr kleine und mittlere Unternehmen (KMU) an den Helpdesk, auch wenn diese nicht in den Anwendungsbereich des Lieferkettengesetzes fallen. Denn das LkSG kann auch auf sie Auswirkungen haben und durch die zunehmende Verrechtlichung steigt die Sichtbarkeit und Sensibilität für das Thema.
Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Wenn Unternehmen außerhalb des Anwendungsbereichs liegen, aber direkte Zulieferer von Unternehmen sind, die unter das Gesetz fallen, können sie darüber zur Umsetzung von Sorgfaltspflichten angehalten werden. Doch die Pflichten aus dem Lieferkettengesetz können ihrer Natur nach nicht einfach an die Zulieferer weitergegeben werden. Das betrifft etwa die Berichtspflichten gegenüber Behörden und der Öffentlichkeit. Auch mit Kontrollmaßnahmen oder Sanktionen durch das BAFA müssen KMUs nicht rechnen.
Die Europäische Lieferkettenrichtlinie (Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD)
Aktuell läuft ein Gesetzgebungsverfahren für ein Pendant zum Lieferkettengesetz auf Europaebene. Genaue Auskünfte über die Ausgestaltung sind daher noch nicht möglich. Es zeichnet sich aber bereits ab, das der Anteil derjenigen Unternehmen, die sich an juridische Anforderungen bezüglich ihrer Lieferkette halten müssen, steigen wird.