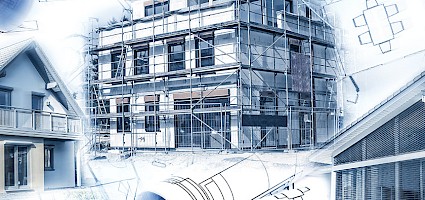Welchen Einfluss hat der Hausbau auf das Klima?
Der Klimawandel ist ein ernstzunehmendes Problem. Allein die Nutzung und der Betrieb von Gebäuden verursacht 33 Prozent des nationalen Treibhausgases; manche Städte wollen den Neubau von Einfamilienhäusern daher nur noch in Ausnahmefällen genehmigen. Mit Hinblick auf den vorherrschenden Wohnungsmangel und die gesteckten Klimaziele faktisch nachvollziehbar, jedoch nur schwierig umsetzbar. Dennoch muss eine Lösung her, um Klimaschutz zu gewährleisten und weiterhin ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Das Wichtigste zum Einfluss vom Hausbau auf das Klima in Kürze
- Der Gebäudesektor treibt die Emissionen stark in die Höhe: in Deutschland rund ein Drittel durch Nutzung/Betrieb von Gebäuden, sodass Bau und Betrieb zentral fürs Klima sind
- Der aktuelle Kurs verfehlt die Klimaziele; besonders der Energieverbrauch im Bestand bleibt entscheidend für die Reduktion
- Sanierung statt Abriss und Neubau spart „graue Energie“, also die Treibhausgase, die durchs Bauen die Herstellung von Baustoffen entstehen, und vermeidet rund ein Drittel der Emissionen, die beim Neubau anfallen würden
- Klimafreundlicher Bau nutzt Holz- und Hybridkonstruktionen, CO₂-speichernde Naturbaustoffe sowie Recycling- und Cradle-to-Cradle-Ansätze
- Klimaschutz und soziale Ziele lassen sich verbinden, indem leerstehender Bestand energetisch ertüchtigt und für bezahlbaren Wohnraum genutzt wird
- Um das Netto-Null im Bausektor bis 2050 zu ermöglichen, muss die Politik klare Anreize und Vorgaben setzen, Neubauten minimieren und Wiederverwendung sowie Kreislaufwirtschaft skalieren

Mit den Pariser Klimazielen hat sich Deutschland eigentlich zu einem umfangreicheren Umweltschutz verpflichtet. Doch besonders erfolgversprechend sind die aktuellen Maßnahmen nicht. Ein wichtiger Baustein wird dabei stark vernachlässigt: die Baubranche. Denn die rasant steigenden Bautätigkeiten sind eine große Klimasünde. Dabei müssten sie es nicht sein. Die Baubranche bietet nämlich schon jetzt zahlreiche Möglichkeiten zur Reduktion des CO2-Ausstoßes - doch diese werden vor allem von der Politik bisher kaum ausgeschöpft.
Inhaltsverzeichnis
- Pariser Klimaziele
- Wie will Deutschland die Klimaziele erreichen?
- Sind wir auf einem guten Kurs, um die Klimaziele einzuhalten?
- Neubau versus Sanieren
- Wichtige Stellschrauben für klimafreundlicheren Hausbau
- Klimaschutz und soziale Nachhaltigkeit gemeinsam denken
- Bausektor klimaneutral: Laut UN keine Utopie
- Fazit: Potenziale besser ausschöpfen
Pariser Klimaziele
2015 haben sich in Paris 195 Staaten dazu verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen zu verringern. Ihr Ziel: Die Erderwärmung idealerweise unter 1,5 Grad Celsius, aber auf jeden Fall unter 2 Grad Celsius zu halten. Bis auf den Iran, Libyen und Jemen haben mittlerweile alle Staaten der Welt dieses wegweisende und bisher einmalige Abkommen unterzeichnet. Die Nationen können dabei selbst festlegen, welche Maßnahmen sie zum Erreichen der Ziele ergreifen wollen. Viele haben etwa das Fliegen, den Autoverkehr oder Plastikmüll in den Fokus gestellt. Weniger im Blick haben die meisten, dass die Baubranche für 38 Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich ist. Diese Zahl umfasst in erster Linie den Bau an sich, aber auch den späteren Betrieb. Damit sind Punkte wie Heizen und Stromverbrauch gemeint.
Wie will Deutschland die Klimaziele erreichen?
Deutschland wollte eigentlich bis 2045 treibhausgasneutral beziehungsweise klimaneutral wirtschaften. Dieses Ziel wurde bereits auf 2050 verschoben. Die Sektoren, auf die sich dabei fokussiert wird, sind Energie, Gebäude, Verkehr, Handel und Industrie. Der Sektor Gebäude wird eng mit Energie gedacht. Eine zukunftsweisende Entwicklung des Gebäudesektors ist laut den Plänen also insbesondere dadurch zu erreichen, dass der Energieverbrauch während der Nutzung reduziert wird. Möglichst sollen die Gebäude sogar mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen.
Sind wir auf einem guten Kurs, um die Klimaziele einzuhalten?
Diese Frage kann ganz klar beantwortet werden: Nein. Aktuell steuern wir auf 2,7 Grad Celsius zu und keine der großen Industrienationen schafft es, sich an das 1,5 Grad-Ziel zu halten. Deutschland ist einer der Haupttreiber der Klimakrise: Mit rund drei Prozent des gesamten Temperaturanstiegs ist Deutschland auf Platz sieben der größten Antreiber des Klimawandels. Für eine Veränderung wären allerdings rigorose politische Anpassungen nötig. Einer dieser wichtigen Hebel ist die Bauindustrie, speziell das Betreiben von Gebäuden.
Neubau versus Sanieren
Eine Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung aus dem Jahr 2020 zeigt auf: In Deutschland wird 33 Prozent aller CO2-Emissionen durch die Nutzung und den Betrieb von Gebäuden produziert. Jährlich sind das ungefähr 400 Millionen Tonnen CO2. Diese werden direkt durch die Beheizung von Räumen verursacht, aber auch die Herstellung der dafür genutzten Brennstoffen. Allein die Beheizung eines Einfamilienhauses setzt jährlich 0,5 bis 1,5 Tonnen CO2 frei. Zwar liegt der CO2-Ausstoß bei der Errichtung von neuen Gebäuden mit 65 Millionen Tonnen CO2 niedriger – allerdings wird durch diese Zahlen schnell deutlich, dass der Hausbau und die Inbetriebnahme von Gebäuden ein deutlicher Treiber von CO2-Gasen ist. Die CO2-Menge des Neubaus setzt sich vornehmlich aus den Lieferketten zusammen als auch der direkten Emissionen der Bauwirtschaft im Hochbau.
Wir haben uns in dem Artikel „Sanieren oder besser neu bauen?” bereits umfangreich damit befasst, welche der beiden Möglichkeiten finanziell sowie ökologisch am sinnvollsten ist. Und auch wenn etwa durch unzureichend gedämmte Gebäude unnötig viel Energie verschwendet wird, legitimiert das aus Umweltschutzperspektive keinen Neubau. Ausschlaggebend dafür ist die sogenannte graue Energie. Unter diesen Begriff fallen sowohl die Treibhausgase, die durchs Bauen entstehen, als auch diejenigen, die für die Herstellung von Baustoffen benötigt werden. Auch jeglicher Transport zur Baustelle zählt dazu, ebenso wie der Abbruch von Gebäuden. Wer sich allerdings für die Sanierung eines Bestandsgebäudes entscheidet, spart ein Drittel der CO2-Emissionen, die beim Abriss und Neubau entstehen würden.
Wichtige Stellschrauben für klimafreundlicheren Hausbau
Warum ist der Bau von Häusern so klimaschädlich? Insbesondere die Herstellung von Beton und Steinen für das Mauerwerk benötigt viel Herstellungsenergie. Außerdem werden dafür große Mengen Sand benötigt, also ein Rohstoff, der weltweit rar wird.
Doch welche Möglichkeiten gibt es, um vor allem den Bau von Massivhäusern klimafreundlicher zu gestalten? Ein Ansatz wäre die Nutzung von Alternativbaustoffen. Ein Holzbau benötigt beispielsweise nur rund die Hälfte der Herstellungsenergie und stößt auch nur halb so viel CO2 aus. Gleichzeitig ist Holz ein natürlicher CO2-Speicher und kann durch andere nachhaltige Baustoffe, die als Innenputz fungieren, erweitert werden. Ein Beispiel hierfür ist Lehm. Natürlich gibt es aber nicht nur das eine oder das andere. Insbesondere bei Mehrfamilienhäusern empfehlen sich Holz-Hybrid-Gebäude, also Mischsysteme aus Holzrahmenbau und Massivbauweise.
Ein anderer Ansatz ist das Recycling von Materialien, etwa nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Die Baubranche sorgt deutschlandweit jährlich für 230 Millionen Tonnen Abfall, das sind mehr als 53 Prozent der jährlichen Abfallmenge. Dies umfasst sowohl den Abfall, der beim Bau entsteht, als auch den, der beim späteren Abriss entsteht. Viele dieser Materialien, die auf der Deponie landen, könnten eigentlich wieder- beziehungsweise weiterverwendet werden – doch das Recycling gestaltet sich als kompliziert und wird durch bürokratische Hürden weiter verkompliziert. Das zeigt zum Beispiel die neue Ersatzbaustoffverordnung.

Klimaschutz und soziale Nachhaltigkeit gemeinsam denken
Der Klimaschutz ist allerdings nicht die einzige gesellschaftliche Herausforderung, vor der wir stehen. In Deutschland fehlen eine Million bezahlbare Wohnungen. Die strengen Vorgaben für klimafreundliche Bauten treiben jedoch eher die Preise in die Höhe, selbst wenn Recyclingbaustoffe oder nachhaltigen Baustoffe verwendet werden.
Wie lassen sich also Klimaziele erreichen und gleichzeitig den Wohnungsmangel bekämpfen? Indem soziale Aspekte im Wohnungsbau mehr Beachtung finden. Der Spagat zwischen bezahlbarem Wohnraum und umweltverträglichem Wohnraum lässt sich nicht bewerkstelligen, da umweltfreundliche Wohnungen in aller Regel sehr teuer vermietet oder verkauft wird. Um dieser Aufgabe zu begegnen, empfiehlt sich die energetische Sanierung gegenüber dem Neubau. Allein in 2022 standen in Deutschland fast zwei Millionen Wohnungen leer, mehr als die Hälfte dieser Wohnungen wurde seit einem Jahr nicht mehr bewohnt. Die Bestandsgebäude bieten jedoch ein enormes Potential, wenn sie nach und nach auf einen angemessenen Stand gebracht werden. Sie können deutlich günstiger vermietet werden – und schaffen zahlreiche Auftragspotentiale für Handwerker und Bauunternehmer.
Bausektor klimaneutral: Laut UN keine Utopie
Auch wenn wir aktuell auf einem schlechten Weg sind, die Klimaziele zu erreichen, ist es noch möglich. Auch ein Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP) und des Zentrums für Ökosysteme und Architektur (CEA) der US-Universität Yale zeigt, dass und wie der Bausektor weltweit klimaneutral werden kann. Das klingt utopisch, wenn man bedenkt, dass aktuell so viele neue Gebäude entstehen, dass alle fünf Tage eine Stadt von der Größe von Paris hinzukommt. Wenn sich die aktuellen Entwicklungen so weiterentwickeln würden, wie in den letzten Jahren, würde sich bis 2060 die Bodenfläche ebenso wie die Verwendung der Rohstoffe fast verdoppeln. Netto-Null-Emissionen seien im Baugewerbe bis 2050 allerdings erreichbar, wenn die Regierungen die richtigen politischen Maßnahmen, Anreize und Vorschriften schaffen, um die Branche zum Handeln zu bewegen. Die wichtigsten Aspekte dafür sind:
- Neubauten sollten möglichst vermieden werden
- Bausubstanzen sollten wiederverwendet werden
- Biologische Rohstoffe aus nachhaltiger Herkunft
- Baustoffe wie Beton, Stahl und Glas umweltfreundlicher produzieren, etwa durch erneuerbare Energien, Recycling und innovative Technologien
Fazit: Potenziale besser ausschöpfen
Umweltfreundliche Baumaterialien, umfangreiches Recycling, Sanieren statt neu bauen. All das sind Stellschrauben, die starke Auswirkungen auf die Klimabilanz des Bausektors haben – die zur Zeit noch nicht ausgeschöpft werden. Aktuell konzentrieren sich Maßnahmen zum CO2-Einsparen im Bausektor auf ihre Funktionen, nachdem gebaut wurde, etwa Heizen, Kühlen und Beleuchten. Doch durch den Ausbau erneuerbarer Energien wird dieser Bereich absehbar umweltfreundlicher. Problematischer sind die rasanten Bautätigkeiten. Industrieländer sollten deswegen stärker auf die Umnutzung bestehender Gebäude setzen und diese wiederverwenden, statt abzureißen und neu zu bauen. Das sind aber auch keine neuen Erkenntnisse. Allerdings haben diese Ergebnisse bisher kaum Auswirkung auf die Realität. Die Aufgabe des Bausektors in den nächsten Jahren besteht also darin, bereits bestehende Potenziale auszuschöpfen. Das kann aber nur geschehen, wenn die Politik mitzieht.
Gratis E-Book: Bieten Sie erfolgreich auf Bauprojekte