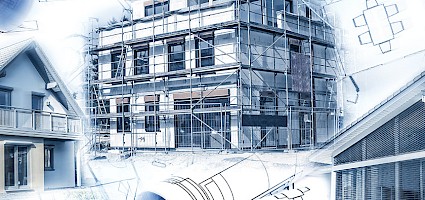Die Wasserstoff-Kontroverse
Wasserstoff wird als Energieträger der Zukunft gegen den Klimawandel gehandhabt: Wasserstoffbetriebene PKW, Heizungen und Stahlproduktion. Doch kann das Element unsere Erwartungen erfüllen und als Schlüssel im Energiesystem dienen?
Das Wichtigste zur Wasserstoff-Kontroverse in Kürze
- Wasserstoff gilt als zentraler Baustein der Energiewende, ist aber nur klimafreundlich, wenn er mit erneuerbarem Strom („grüner Wasserstoff“) produziert wird
- Es gibt verschiedene Wasserstoffarten: grün, grau, blau und türkis – nur grüner Wasserstoff ist wirklich CO₂-neutral
- Hauptnutzen liegt in der Sektorenkopplung: Stromüberschüsse speichern, Industrieprozesse (z. B. Stahlproduktion) dekarbonisieren und Schwerlast-, Schiffs- sowie Luftverkehr versorgen
- Für Heizung und PKW ist Wasserstoff meist ineffizient und zu teuer – direkte Elektrifizierung (Wärmepumpe, Batterieauto) ist hier oft sinnvoller
- Hohe Produktionskosten, begrenzte Verfügbarkeit und Infrastrukturprobleme sind aktuell die größten Hürden
- Perspektivisch muss ein globaler Markt entstehen, um günstigen grünen Wasserstoff aus sonnen- und windreichen Regionen zu importieren

Nicht wenige Leute nennen, wenn man sie fragt, was sie mit Wasserstoff verbinden, den Zeppelin “Hindenburg”. Der mit Wasserstoff betriebene Zeppelin ging 1937 beim Landeanflug in Flammen auf, 36 Menschen starben. Die Energie, die bei der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser frei wird, ist augenscheinlich enorm. Das Unglück hat gezeigt, welche Gefahren das birgt. Zugleich eröffnen sich damit aber auch zahlreiche Chancen für die Sektorenkopplung. Damit ist eine Verknüpfung der Strom-, Wärme- und Verkehrsindustrie gemeint. Besonders für die Energiewende spielt die Sektorenkopplung eine entscheidende Rolle. Nicht ohne Grund gilt Wasserstoff als “Champagner der Energiewende” und wird von der Bundesregierung, aber auch der Automobilindustrie als Energieträger der Zukunft angepriesen. Schließlich stehen fossile Brennstoffe schon lange unter kritischer Beobachtung. Auch die Heizungsindustrie träumt davon, ihre Gaskessel künftig mit Wasserstoff zu befeuern. Da das einzige Produkt der Verbrennung Wasser ist, ist die Energiewende mit Wasserstoff CO2-neutral. Außerdem haben wir Wasserstoff en masse. Als das häufigste chemische Element stellt es 75 Prozent der Masse und 93 Prozent aller Atome des Sonnensystems. Und auch, wenn Wasserstoff auf der Erde deutlich seltener vorkommt, handelt es sich immer noch um extreme Mengen. Aber wie realistisch ist es, dass unsere Welt irgendwann Wasserstoff-betrieben ist? In welchen Bereichen kann Wasserstoff als Energieträger gewinnbringend eingesetzt werden, wo gibt es sinnvollere Alternativen?
Inhaltsverzeichnis
- Geschichte und Herstellung: Ist Wasserstoff umweltfreundlich?
- Klassifikation von Wasserstoff
- Klassifikation von Wasserstoff // 2
- Wie funktioniert Wasserstoff als Energieträger?
- Kann Wasserstoff Erdgas ersetzen?
- Heizen mit Wasserstoff: Besser als Wärmepumpe und Co.?
- Wasserstoff in der Stahlindustrie und als Kohleersatz
- Das Kostenproblem
- Die Effizienz von Wasserstoff als Treibstoff
- Fazit: Ist Wasserstoff der Energieträger von morgen?
Geschichte und Herstellung: Ist Wasserstoff umweltfreundlich?
Der Traum von Wasserstoff als Energieträger ist alles andere als neu. Der Schriftsteller Jules Verne hat Wasser in seinem Roman “Die geheimnisvolle Insel” von 1874 als “Kohle der Zukunft” bezeichnet. Doch ein Unterschied zwischen Wasser und Kohle ist offenbar: Das eine gilt gemeinhin als umweltschädlich, das andere nicht. Doch ob Wasserstoff tatsächlich klima- und umweltfreundlich ist, hängt von seiner Produktion ab. Wasserstoff liegt aufgrund seiner hohen Reaktivität fast ausschließlich gebunden vor und muss, wenn man es nutzen möchte, durch Strom aus Wasser abgespalten werden. Dieses Verfahren nennt man Elektrolyse oder auch “Power to Gas”. Damit bei der Produktion von Wasserstoff keine klimaschädlichen Gase entstehen, sollte der Strom aus erneuerbaren Quellen kommen.
Das Konzept gibt es seit den 1970er Jahren und seit 1989 wird an der Wasserstoffproduktion in großem Maßstab geforscht. Damals errichteten Forscher:innen im bayerischen Städtchen Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz eine Solar-Wasserstoff-Anlage, wo das Gas mit Hilfe von Solarzellen erzeugt wurde. Zehn Jahre später entstand ein ähnliches Projekt in der Wüste Saudi-Arabiens. Am Bau war auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR beteiligt. Projekte wie diese waren revolutionär und wegweisend, allerdings verhalfen sie nicht zum großen Durchbruch. Obwohl zur Jahrtausendwende die ersten Wasserstofftankstellen eingerichtet wurden, blieb Wasserstoff teuer, während fossile Energieträger wie Erdöl und Erdgas günstig blieben.
Aufgrund der Erderwärmung drängt das Europäische Parlament seit 2007 die EU-Mitgliedsstaaten dazu, eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen. Als erstes Land weltweit beschloss Japan 2017 eine nationale Wasserstoffstrategie, andere Staaten folgten, etwa Deutschland im Juli 2020. Das Europaparlament möchte durch den Aufbau einer europäischen Wasserstoffwirtschaft die selbstgesteckten Klimaziele erreichen, denn laut eines Berichtes vom 19. Mai 2021 können durch Wasserstoff bis 2050 jährlich rund 560 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.
Klassifikation von Wasserstoff
Wie bereits gesagt, ob Wasserstoff klimafreundlich ist, hängt davon ab, wie er produziert wird. Um zu kennzeichnen, wie der Wasserstoff hergestellt wurde und entsprechend seine Ökobilanz ausfällt, wird Wasserstoff unterschiedlich benannt.
Grüner Wasserstoff | Bei der Elektrolyse von Wasser durch Strom wird es in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Kommt der dafür genutzte Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen, spricht man von grünem Wasserstoff, da dieser allgemein als CO2-neutral gilt. |
|---|---|
Grauer Wasserstoff | Wasserstoff kann auch aus Erdgas hergestellt werden. Dabei entstehen pro Tonne Wasserstoff ungefähr zehn Tonnen CO2, die ungenutzt in die Atmosphäre abgegeben werden. In diesem Fall spricht man von grauem Wasserstoff. |
Blauer Wasserstoff | Hierbei handelt es sich um grauen Wasserstoff, bei dem das entstandene CO2 abgeschieden und gespeichert wird. Statt in die Atmosphäre zu gelangen wird das Treibhausgas in den Bode gepresst. Die Bundesregierung bezeichnet dieses Verfahren als CO2-neutral. Umweltschützer:innen bezweifeln, ob die unterirdische Lagerung über Jahrhunderte hinweg dicht bleibt. Auch bleiben in der Betitelung der Bundesregierung die Emissionen durch Förderung und Transport von Erdgas unberücksichtigt. Greenpeace nennt einen CO2-Ausstoß von 220 g pro Kilowattstunde Wasserstoff. |
Türkiser Wasserstoff | Türkiser Wasserstoff wird durch die thermische Spaltung von Methan hergestellt. Dabei entsteht statt CO2 fester Kohlenstoff. Die Spaltung findet in Hochtemperaturreaktoren statt. Werden diese mit erneuerbaren Energien befeuert und wird der entstandene Kohlenstoff dauerhaft gebunden, kann auch diese Herstellung als CO2-neutral bezeichnet werden. |
Diese unterschiedlichen Bezeichnungen zeigen, dass Wasserstoff nicht immer die bessere Alternative zu Erdgas oder anderen fossilen Energieträgern ist. Wenn Wasserstoff in großem Maßstab eingesetzt werden und einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten soll, muss grüner Wasserstoff genutzt werden. In Deutschland produziert allerdings noch niemand grünen Wasserstoff im kommerziellen Stil. Die Bundesregierung will den Markthochlauf mit neun Milliarden Euro fördern, um die Elektrolyse-Kapazität bis 2030 auf fünf Gigawatt zu steigern. Aber selbst damit könnte höchstens ein Fünftel des Bedarfs gedeckt werden, sodass Deutschland beim grünen Wasserstoff stark von Importen abhängig bliebe. Auch der Lobbyverband “Zukunft Gas” bezweifelt, dass grüner Wasserstoff in ausreichenden Mengen zu marktfähigen Kosten produziert werden kann.
Alternativ stellt die Methanpyrolyse zur Gewinnung von türkisem Wasserstoff eine Möglichkeit dar, Wasserstoff möglichst klimaschonend zu erzeugen. Das setzt jedoch die Nutzung erneuerbarer Energien voraus. Zudem muss der gewonnene Kohlenstoff im Anschluss dauerhaft gelagert werden, um das Eindringen in die Atmosphäre zu verhindern – beispielsweise durch den Einsatz in der Bau- oder Werkstoffindustrie sowie im Straßenbau.
Für kleine Mengen von Wasserstoff stellt die Methanpyrolyse also kein Problem dar. Doch in großem Umfang stößt das Verfahren an seine Grenzen, wenn die Lagerung des Kohlenstoffs nicht mehr sichergestellt werden kann. Im Vergleich zur Elektrolyse benötigt die Methanpyrolyse jedoch deutlich weniger elektrischen Strom, da sich die Bindungen dabei wesentlich leichter lösen lassen. Die Entscheidung darüber, welches Verfahren nun klimafreundlicher ist, hängt somit von der benötigten Menge an Wasserstoff ab.
Wie funktioniert Wasserstoff als Energieträger?
Wasserstoff ist der Hoffnungsträger für viele Sektoren, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen. Aber wie kann Wasserstoff im Energiesystem genutzt werden? Wie wir bereits erklärt haben, lässt sich mittels Elektrolyse grüner Wasserstoff herstellen. Diese Technologie kann zur indirekten Stromspeicherung verwendet werden. Denn besonders bei erneuerbaren Energiequellen lässt sich nicht kontrollieren, wann Strom, in welchen Mengen erzeugt werden soll. So passiert es immer wieder, dass zeitweise zu viel Strom produziert wird und nicht genügend Abnehmer:innen existieren. Mittels Elektrolyse kann dieser Überschuss in Wasserstoff umgewandelt und anschließend in Kavernenspeichern gelagert werden. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt wieder mehr Strom benötigt werden, durchläuft man den Prozess einfach rückwärts. Der gespeicherte Wasserstoff kommt in einem umgekehrten Elektrolyse-Prozess als Brennstoff zum Einsatz und wird mit Sauerstoff verbunden. Dabei entsteht Energie, die dann ins Stromnetz gespeist werden kann. Alternativ kann man den gespeicherten Wasserstoff auch nutzen, um durch Hinzufügen von CO2 Wasser und Methan herzustellen. So stellt Wasserstoff eine wertvolle Alternative im Energiesystem dar und legt den Grundstein für vielerlei Branchen, zum Energieträger der Zukunft zu werden. Doch was gibt es noch für mögliche Technologien? Schließlich sind Elektrolyseanlagen und damit die Gewinnung von grünem Wasserstoff teuer. Eine mögliche Technologie ist die Erzeugung von Wasserstoff aus Biomasse – oft auch als Biowasserstoff bekannt. Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger plädiert zum Beispiel für die Nutzung nicht anderweitig verwendbarer Biomasse, wie Abfall- und Reststoffe. Er fordert mehr Offenheit für alternative Technologien in der Wasserstoffstrategie. In den meisten Fällen wird Biomüll einfach verbrannt, um daraus Strom zu erzeugen, dabei entstehen Kohlendioxid-Emissionen, die der Umwelt schaden. Deshalb möchten Forscher:innen effizientere Methoden finden. Sie schlagen vor, aus der Biomasse Wasserstoff herzustellen und das dabei produzierte Kohlendioxid zu speichern. Dieses kann dann zum Beispiel in der chemischen Industrie als Rohstoff eingesetzt oder im Boden gespeichert und dadurch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre reduziert werden. Andere Expert:innen schlagen vor, Bioenergie-Verfahren mit grünem Wasserstoff aus der Elektrolyse zu verbinden. Daraus könnte man erneuerbare Kohlenwasserstoffe herstellen, die ebenfalls in der Chemieindustrie eingesetzt werden können.
Kann Wasserstoff Erdgas ersetzen?
Der Angriff Russlands auf die Ukraine im vergangenen Jahr löste einen erheblichen Mangel an russischem Erdgas aus. Die Folge: Europa sucht nun nach einer effizienteren und vor allem klimafreundlicheren Alternative. Erneuerbare Energien sind zwar äußerst nützlich und schonend für die Umwelt, doch sie richten sich nicht nach den menschlichen Bedürfnissen. So produzieren Wind- oder Photovoltaikanlagen auch Strom, wenn er nicht akut benötigt wird – und mitunter wird kein Strom erzeugt, wenn er gerade benötigt wird. Doch nun gibt es Lösungsansätze: Die überschüssige erneuerbare Energie kann genutzt werden, um daraus Wasserstoff herzustellen. Auf diese Weise soll langfristig der Verbrauch von Kohlenwasserstoffen – vorwiegend Erdgas – reduziert werden. Doch ist ein Austausch überhaupt so einfach möglich? Es bestehen wesentliche Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung von Erdgas und Wasserstoff, wodurch ein Eins-zu-eins-Austausch nicht ohne Weiteres möglich ist. Bestehende Gasleitungen müssten vorerst für den Transport von Wasserstoff umgebaut werden. Während einige Röhren vollständig neu gebaut werden müssen, können andere lediglich umgebaut werden, was sich auch auf die Kosten auswirkt. Doch in Öhringen wurde in den letzten Jahren nach einer weiteren Lösung gesucht. Gemeinsam mit der Projektleiterin Dr. Heike Grüner von der Netze BW haben die Anwohner:innen eine Wasserstoff-Insel entwickelt. Die örtliche Betriebsstelle wird seit 2021 mit einem Gemisch aus Wasserstoff und Erdgas versorgt – im vergangenen Jahr konnten bereits 30 Prozent Wasserstoff beigemischt werden. Auf diesem Weg versucht man langfristig eine Umstellung auf grüne Gase zu erreichen.
Heizen mit Wasserstoff: Besser als Wärmepumpe und Co.?
Wasserstoff als Brennstoff kann unter anderem auch zum Heizen eingesetzt werden, insbesondere um Erdgas zu ersetzen. Verschiedene Hersteller:innen sind aktiv an der Forschung beteiligt, etwa Viessmann. Das Unternehmen hat die Gas-Brennwert-Heizung seiner Vitodens-Baureihe überarbeitet, um sie an Verbrennungseigenschaften von Wasserstoff anzupassen. Anfang 2023 sind die Geräte in Kaisersesch, einer rheinland-pfälzischen Gemeinde am Rande der Eifel, in den Praxistest gegangen. Die Markteinführung ist derzeit für 2025 geplant. Auch Bosch Thermotechnik betreibt im englischen Worcester seit 2017 Prototypen eines sogenannten H2-Ready-Heizkessels mit Wasserstoff und Remeha hat Anfang 2021 für zwei Gas-Brennwert-Wandkessel die erste Wasserstoffzertifizierung in den Niederlanden erhalten. Die Geräte Celena Ace und Tzerra Ace sind für die Verwendung von bis zu 20 Prozent Wasserstoff zugelassen, wodurch die Emissionen laut Herstellerangaben um rund acht Prozent gesenkt werden. Im niederländischen Rozenburg verteilt die BDR Thermea Group grünen Wasserstoff über ein eigenes Gasnetz. Reine Wasserstoffkessel versorgen ein Dutzend Haushalte CO2-neutral mit Wärme und Warmwasser.
Das Attraktive am Heizen mit Wasserstoff als Brennstoff ist, dass die Umstellung von Erdgas denkbar einfach ist. Wer von einer konventionellen Heizung auf eine Wärmepumpe wechseln will, muss viel in die Dämmung investieren. Ein Wasserstoff-Heizkessel kommt ohne zusätzliche Modernisierungsmaßnahmen aus. Und statt teure Stromtrassen zu bauen, kann die vorhandene Infrastruktur für den Transport von Wasserstoff genutzt werden. Dennoch sehen viele Expert:innen die Umstellung kritisch. Grüner Wasserstoff ist nur begrenzt vorhanden und noch dazu sehr teuer. Das Argument für erspartes Geld in der Infrastruktur ist damit schnell entkräftet. Zudem gibt es laut den Energieexpert:innen bereits zahlreiche Alternativen, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. Dazu gehören Solarthermien, Geothermien oder Umweltwärme. Im Vergleich zu Wasserstoff oder synthetischem Methan sind diese Lösungsansätze wesentlich kostengünstiger und ersetzen sogar mehr fossile Brennstoffe. Stattdessen soll Wasserstoff dort eingesetzt werden, wo es bisher keine oder wenig alternative Lösungen gibt, so auch in der Stahl- oder Chemieindustrie.
Wasserstoff in der Stahlindustrie und als Kohleersatz
Die ehemalige Bundesforschungsministerin Karliczek sagt, dass etwa sechs Prozent der weltweiten CO2-Emission auf die Stahlproduktion zurückzuführen seien, in der EU sogar ganze 22 Prozent. Stahl gänzlich grün zu produzieren, wäre entsprechend ein riesiger Schritt. Deshalb sollen die traditionellen Hochöfen durch Direkt-Reduktionsanlagen ersetzt werden. Die bisherige Kombination aus Kohlenstoff und Eisenerz kann dann durch Wasserstoff abgelöst werden. Die dabei entstehenden Eisenschwämme müssen dann eingeschmolzen werden, was mit grünem Strom erfolgen kann, sodass die Produktion von Stahl perspektivisch komplett CO2-frei möglich ist. Die Direktreduktion von Eisenerz ist kein Neuland, denn auf Erdgasbasis wird die Technik schon seit Längerem angewandt. So wird zwar weniger Kohlendioxid freigesetzt, aber klimaneutral ist der Stahl noch immer nicht. Erdgas und Wasserstoff können dabei gemischt eingesetzt werden und die Anteile sind flexibel. Um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren, sollte der Anteil an grünem Wasserstoff möglichst groß sein.
Vorreiter bei der grünen Stahlproduktion ist Schweden. Bereits 2022 wurde dort die erste Pilotanlage fertiggestellt. Im Rahmen eines Hybrit-Projekts planen sie die fossilfreie Herstellung von Stahl und haben dafür bis Ende 2023 eine Wasserstoff-Speicheranlage auf dem Strommarkt getestet. Die erfolgreiche Kombination von Wasserstoff am Strommarkt legt den Grundstein für weitergehende Forschungen und die Möglichkeit, bis 2050 alle Geräte umzustellen. So können insgesamt rund elf Prozent des schwedischen und sieben Prozent des finnischen CO2-Ausstoßes eingespart werden. Auch in Deutschland plant die Thyssenkrupp AG nun ihren ersten wasserstoffbetriebenen Hochofen in Betrieb zu nehmen. Doch einer weitergehenden Entwicklung in Deutschland stehen schon wieder die altbekannten Probleme entgegen: Es gibt zu wenig grünen Wasserstoff und der, den es gibt, ist zu teuer.
Wasserstoff ist bis dato theoretisch die einzige Möglichkeit, grünen Stahl herzustellen, abgesehen davon, dass man die anfallenden CO2-Emissionen für die Produktion chemischer Grundstoffe weiterverwendet. Da die Stahlproduktion über kurz oder lang klimaneutral werden muss, ist die Situation gewissermaßen alternativlos. Allerdings ist die wasserstoffbasierte Produktion ziemlich herausfordernd, insbesondere wirtschaftlich. Damit die Stahlindustrie in Deutschland wettbewerbsfähig bleibt, darf eine Tonne des Gases maximal 2.000 Euro kosten, momentan liegt der Preis für grünen Wasserstoff allerdings bei 4.000 bis 6.000 Euro. Grauer Wasserstoff kostet zwischen 2.000 und 4.500 Euro, doch löst er das Problem nicht. Zudem muss in der Stahlindustrie einiges umgebaut werden. Geschätzt werden dazu in den kommenden Jahren 30 Milliarden Euro benötigt. In Anbetracht zahlreicher veralteter Anlagen und ihrer notwendigen Erneuerung kann dies aber auch als Chance einer innovativen Neuausrichtung gesehen werden. Um eine technische Umstellung dieser Größenordnung bewerkstelligen zu können, fordern Beteiligte Unterstützung seitens des Staates. Die könnte etwa so aussehen, dass Elektrolyseure, die erneuerbaren Strom nutzen, von Letztverbraucherabgaben befreit und Markteinführungsprogramme gestartet werden, die die Nachfrage nach grünem Wasserstoff erhöhen.
Das Kostenproblem
Was schon seit langem und immer wieder diskutiert wird, ist Wasserstoff als Treibstoff einzusetzen. Die Frage “Wasserstoff oder Strom?” ist dabei fast schon zu einer Glaubensfrage geworden. In beiden Fällen treibt ein Elektromotor das Auto an, der Unterschied ist aber, dass der Strom in einem Fall direkt aus der Batterie kommt und im anderen von einer Brennstoffzelle im Fahrzeug erzeugt wird. Vor ein paar Jahren noch hatten die Wasserstofffahrzeuge die Nase vorn und sollten Diesel und Benziner ersetzen. Heute dominieren eindeutig die E-Autos mit Akkus als Energiespeicher. Ein Grund dafür sind technische Fortschritte bei den Batterien. Anfangs war die Reichweite sehr gering, inzwischen kommen einige Modelle auf rund 600 Kilometer, ohne an einer Ladesäule halten zu müssen. Derzeit erhältliche PKW mit Wasserstoff-Antrieb haben eine ähnliche Reichweite, sind aber deutlich teurer und die Ladeinfrastruktur ist noch schlechter als die für E-Autos. In Deutschland gibt es nicht einmal 100 Wasserstofftankstellen, verglichen mit knapp 15.000 herkömmlichen Tankstellen. Das führt zu mehreren klassischen Henne-Ei-Situationen: Wenn die Nachfrage steigt, werden die Preise sinken, aber zugleich wird die Nachfrage nur dann steigen, wenn die Infrastruktur ausgebaut wird, die aber nur ausgebaut wird, wenn die Nachfrage steigt.
Zudem ist Wasserstoff, also der grüne, gute Wasserstoff, teuer. Aus den Zapfsäulen heute kommt grauer Wasserstoff, der genau so viel kostet wie Benzin, da CO2 billig ist. Beim grünen Wasserstoff dagegen sind aktuell die Produktionskosten noch zu hoch. Wettbewerbsfähig wird er erst, wenn man fossile Energieträger mit einer sehr hohen CO2-Steuer belegt. Auch wenn Fachleute erwarten, dass sowohl die Elektrolyse in den kommenden Jahren effizienter wird, als auch, dass der Preis für Strom aus Wind und Sonne sinkt, wird das noch lange dauern. Grundsätzlich gilt: Je günstiger der Strom, desto günstiger der Wasserstoff. Günstig lässt sich der Strom insbesondere dort produzieren, wo die Sonne besonders stark scheint und der Wind stark bläst. Auch die Produktion mit Wärme, also in solarthermischen Kraftwerken, könnte effizient sein. Allerdings funktionieren solche Anlagen erst in südlichen Breiten wie Südspanien, Sizilien oder Nordafrika. China, aber insbesonder Korea und Japan setzen stark auf diese Vorteile von Wasserstoff. Es gibt sehr konsequente Förderprogramme. Allerdings setzen sie bei der Produktion auf nicht wirklich umweltfreundliche Verfahren, wie Gas-Reformierung und Atomstrom. Für die Unabhängigkeit von Ölimporten nehmen sie sehr hohe Treibstoffpreise in Kauf.
Die Effizienz von Wasserstoff als Treibstoff
Doch viel wichtiger ist die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, Fahrzeuge mit Wasserstoff anzutreiben. Ein erheblicher Nachteil des Wasserstoffantriebs, der sich nicht so einfach beheben lässt, ist die Energieeffizienz. Die meisten Fachleute plädieren dafür, direkt mit Strom zu fahren, statt zunächst mit Strom Wasserstoff zu produzieren, um diesen dann zu tanken und daraus wiederum Strom zu machen, mit dem das Fahrzeug dann betrieben wird. Nur wenn ein Fahrzeug mehrere Tonnen wiegt und der Energiebedarf besonders hoch ausfällt, könne Wasserstoff als Treibstoff sinnvoll sein, also bei Bussen, LKW oder im See- und Luftverkehr. Ähnliches gilt für Züge, wenn Oberleitungen fehlen, was bei mehr als einem Drittel des deutschen Bahnnetzes der Fall ist. Denn die gravimetrische Speicherdichte ist sehr hoch, das bedeutet, dass der Brennwert von einem Kilogramm Wasserstoff bei 33 Kilowattstunden liegt, also bei mehr als dem Dreifachen des Energiegehalts von einem Liter Benzin oder Diesel. In diesen Bereichen können alternativ jedoch auch Kohlenwasserstoffe oder Ammoniak verwendet werden, zu deren Herstellung wiederum Wasserstoff als Ausgangsstoff eingesetzt wird.
Auch preislich sind Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge nicht ideal. Die Brennstoffzellen-Stacks in den neuesten Automodellen kosten in der Herstellung fünfstellige Dollar- oder Eurobeträge, unter anderem weil darin teure Edelmetalle wie Platin verbaut werden müssen. Der Prozess in den Brennstoffzellen mag recht einfach sein, die Zelle selber als Industrieprodukt ist dies aber nicht. Soll die Zelle etwa Minusgrade aushalten können, müssen Wasserreste aus dem Stack geblasen werden. Damit die Reaktion starten kann, muss die Zelle zudem vorgeheizt werden. Weil dabei Abwärme entsteht, ist eine Kühlung nötig. Und die von der Kühlung angesaugte Luft muss sehr aufwendig gefiltert werden, da sich Verschmutzungen wie Staubpartikel auf der Zell-Membran ablagern und auf Dauer die Leistung reduzieren würden. Aber selbst mit gefilterter Luft ist die Dauer einer Brennstoffzellenmembran eine kritische Größe. Da die Leistungssteuerung einer Brennstoffzelle komplex und relativ träge ist dauert es Sekunden vom Druck aufs Gaspedal bis zur Reaktion des Antriebs, weshalb ein Brennstoffzellen-Fahrzeug immer auch einen Akku als Puffer für die elektrische Energie braucht.
Konkludieren kann man allerdings, dass Wasserstoff wohl kaum eine Karriere in diesem Bereich machen wird, sondern eher in anderen. In diesem Bereich wird sich voraussichtlich eher die direkte Anwendung von Strom aus erneuerbaren Quellen durchsetzen. Bei einer Überproduktion wird dieser in der Wasserstoffproduktion eingesetzt und der Wasserstoff wiederum kann in anderen Bereichen, wie der Stahlverhüttung oder als Kohleersatz genutzt werden. In diesen Bereichen ist das CO2-Einsparungspotential pro eingesetztem Kilogramm Wasserstoff deutlich größer als bei Brennstoffzellenautos und der technische Aufwand zugleich relativ gering.
Fazit: Ist Wasserstoff der Energieträger von morgen?
Wasserstoff ist kein Allheilmittel. Da die Herstellung drei- bis fünfmal so viel Energie bedarf wie die direkte Nutzung erneuerbarer Energie, wird man Wasserstoff in Zukunft nur da einsetzen, wo es keine andere, vor allem elektrische, Möglichkeit gibt. Wichtige Einsatzgebiete werden deswegen vor allem die Industrie sowie der Schiffs-, Schwerlast- und Flugverkehr sein.
Ein entscheidender Vorteil von Wasserstoff ist allerdings, dass so die Energie, wenn es nötig ist, monatelang in Druckbehältern oder Gaskavernen gespeichert werden kann. Insbesondere als Speicher für den schwankenden Strom aus Solarzellen und Windrädern wird Wasserstoff deswegen hoch gehandelt. Um die Wasserstoffstrategie auf lange Sicht rentabel zu machen, muss ein robuster Markt geschaffen werden. Das ist nur möglich, wenn global gedacht wird. In Ländern mit vielen Sonnenstunden ist eine deutlich günstigere Wasserstoffproduktion möglich. Länder wie Ägypten, Marokko, die Ukraine, Australien und die USA müssen also ins Boot geholt werden.