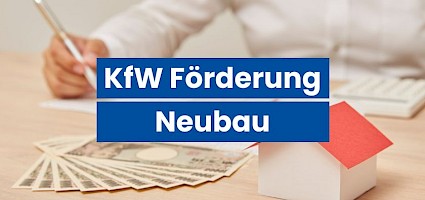Dachbegrünung als Pflicht: Wie Städte die Natur zurückholen
Die Vorteile von Dachbegrünung sind unumstritten: Sie sorgt für bessere Luft, schafft Lebensräume und entlastet Kanalisationen, indem Regenwasser gespeichert wird. In Berlin und anderen Großstädten ist sie bereits Pflicht. Aber wird sie demnächst auch bundesweit umgesetzt?
Das Wichtigste zur Dachbegrünung als Pflicht in Kürze
- Immer mehr Städte wie Berlin, Hamburg oder Stuttgart schreiben Dachbegrünung für Neubauten vor, um Klima, Regenmanagement und Biodiversität zu verbessern
- Die Begrünungspflicht für Dächer ist eine bauliche Vorgabe, die vorschreibt, dass bestimmte Dächer begrünt werden müssen
- Gründächer speichern Regenwasser, senken Temperaturen, verbessern das Klima und schaffen Lebensräume für Insekten und Vögel
- Bauherr:innen profitieren von besserem Raumklima, längerer Dachlebensdauer und niedrigeren Heiz- und Kühlkosten
- Umsetzungsaufwand und Kosten liegen höher als bei Kiesdächern, regelmäßige Pflege ist notwendig, um Schäden zu vermeiden
- Förderprogramme von Kommunen und der KfW unterstützen mit Zuschüssen und Gebührenvergünstigungen
- Kombination mit Photovoltaik („Solargründach“) steigert PV-Erträge und macht Dächer zu multifunktionalen Klimaschutzflächen

Ab dem 1. Januar 2024 war es in Berlin so weit: Neubauten, die eine Dachneigung von bis zu zehn Grad hatten, sollen ab sofort mit Dachbegrünung bebaut werden. Auch in Städten in NRW, Baden-Württemberg und Bayern hat sich die Gründach-Pflicht durchgesetzt. Denn bereits ein Achtel von Deutschland ist durch Beton versiegelt – da bieten die sonst ungenutzten Flächen von Flachdächern Potenzial für besseres Regenmanagement und die Rückholung von Lebensräumen von Insekten und Kleintieren. Doch was bedeutet eine Begrünungspflicht für Dächer für Bauherr:innen und Architekt:innen? In welchen Regionen und Städten gilt sie bereits? Erfahren Sie in unserem Artikel, was es zu beachten gibt!
Inhaltsverzeichnis
- Was bedeutet die Begrünungspflicht für Dächer?
- Dachbegrünung wird zur Pflicht: In welchen Gebieten sie bereits gilt
- Ausnahmen von der Dachbegrünungspflicht: Diese Gebäude sind von der Pflicht befreit
- Dachbegrünung für ein besseres Klima: Vorteile des Gründachs
- Gibt es Nachteile einer Dachbegrünung?
- Gründach Förderungen: Wie lässt sich Dachbegrünung finanzieren?
- Solargründach-Pflicht: Wie lässt sich Photovoltaik mit Gründach kombinieren?
- Fazit: Schwammstadt-Konzept als Zukunft des Städtebaus
Was bedeutet die Begrünungspflicht für Dächer?
Die Begrünungspflicht für Dächer ist eine bauliche Vorgabe, die vorschreibt, dass bestimmte Dächer – meist Flachdächer – begrünt werden müssen. Dabei wird sich in der Regel auf jegliche Art aller Neubauten bezogen – je nach städtebaulichen Vorschriften auf sowohl öffentliche als auch private Gebäude. Das Ziel dieser Regelung ist es, das Stadtklima zu verbessern und Regenwasser zurückzuhalten, damit Abwässer geschont werden. Dadurch soll Auswirkungen des Klimawandels, wie hohen Temperaturen oder Überschwemmungen, entgegengewirkt werden.
Wie sieht eine Dachbegrünung aus?
Ein Gründach ermöglicht die natürliche Speicherung von Regenwasser: Anfallendes Regenwasser wird aufgenommen und gespeichert, statt direkt an die Kanalisation abgegeben zu werden. Für die versiegelte Fläche auf dem Bodengrundstück wird somit eine gleich große Ausgleichsfläche auf dem Dach eingeplant.
In der Praxis setzt sich die Dachbegrünung aus verschiedenen Schichten zusammen. Auf die durchwurzelungsfeste Abdichtung folgt ein Trenn- und Schutzvlies, darüber eine Dränschicht zur Abführung von überschüssigem Wasser. Anschließend kommt eine Vegetationstragschicht aus Substrat und einer Bepflanzung aus beispielsweise Kräutern, Gräsern oder Moosen.
Man unterscheidet zwischen extensiver und intensiver Dachbegrünung:
Extensive Dachbegrünung | Intensive Dachbegrünung | |
|---|---|---|
Vegetation | Niedrig wachsende Pflanzen | Rasenfläche mit Kleinpflanzen, Sträuchern, Bäumen |
Gewicht | 80 bis 180 Kilogramm pro Quadratmeter | Ab 200 Kilogramm pro Quadratmeter |
Installation | Auch geeignet für eine nachträgliche Installation | Erfordert eine Baugenehmigung, da Absturzsicherung und Statik gewährleistet werden müssen |
Dachbegrünung wird zur Pflicht: In welchen Gebieten sie bereits gilt
Bis jetzt ist Dachbegrünung keine bundesweite Pflicht, sondern wird in städtischen Satzungen oder den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Landkreise und Kommunen können im Bebauungsplan Dachbegrünung für Flachdächer oder Dächer mit geringer Neigung vorschreiben.
Dabei gibt es bereits einige Städte und Gemeinden, die die Dachbegrünung zur Pflicht gemacht haben, darunter auch in NRW, Bayern und Baden-Württemberg. Eine Unterscheidung zwischen gewerblichen Gebäuden und Wohngebäuden gibt es hierbei nicht – es wird sich lediglich auf die Größe der Dachfläche bezogen.
Welche Gebäude sind von der Begrünungspflicht betroffen? | Wie viel Fläche muss begrünt werden? | |
|---|---|---|
Berlin | ✓ Alle Neubauten mit einer Dachfläche von 100 Quadratmetern und einer Dachneigung von bis zu zehn Grad Bei bis zu fünf Grad: intensive Begrünung Bei von fünf bis zehn Grad: extensive Begrünung | Mindestens 60 Prozent |
Frankfurt am Main | ✓ Alle Neubauten mit einer Dachfläche von mindestens 500 Quadratmetern | Mindestens 50 Prozent |
Hamburg | ✓ Alle Neubauten mit einer Dachfläche von mindestens 200 Quadratmetern | Keine Angabe |
Köln | ✓ Alle Neubauten mit einer Dachfläche von mindestens 500 Quadratmetern | Mindestens 50 Prozent |
Leipzig | ✓ Alle Neubauten mit flachgeneigten Dächern ✓ Bei Änderungen von Bestandsgebäuden | Keine Angabe |
München | ✓ Alle Neubauten mit einer Dachfläche von mindestens 250 Quadratmetern | Keine Angabe |
Stuttgart | ✓ Alle Neubauten mit einer Dachfläche von mindestens 150 Quadratmetern | Keine Angabe |
Die Umsetzung der Gründach-Pflicht sollte nicht vernachlässigt werden. Denn wird sie nicht eingehalten, können nicht nur Bußgelder drohen, sondern auch die Baugenehmigung kann verweigert werden. In beispielsweise Stuttgart oder Hamburg überprüfen die jeweiligen Bauämter, ob die Vorschriften befolgt werden.
Ausnahmen von der Dachbegrünungspflicht: Diese Gebäude sind von der Pflicht befreit
Die konkreten Ausnahmen werden in den jeweiligen Landesbauordnungen oder in den städtischen Satzungen bestimmt. Sie greifen unter anderem bei Gebäuden, bei denen ein Gründach baulich nicht umsetzbar ist.
- Denkmalgeschützte Gebäude, deren historisches Erscheinungsbild erhalten werden soll, können von der Pflicht befreit sein.
- Sollen Dächer von beispielsweise gewerblichen Gebäuden für andere Zwecke, wie Photovoltaik-Anlagen, genutzt werden, kann von der Begrünungspflicht befreit werden.
- Bei Bestandsgebäuden, die von der Pflicht betroffen sind (beispielsweise in Leipzig): Ist die Statik nicht ausreichend, um das Gewicht der Begrünung zu tragen, können sie von der Pflicht befreit werden.
Dachbegrünung für ein besseres Klima: Vorteile des Gründachs
Zwar ist die Dachbegrünung für Bauherr:innen und Architekt:innen in der Vorplanungsphase mit Mehraufwand und Investitionskosten verbunden. Allerdings ist sie in vielen Aspekten sehr sinnvoll. Zum einen ist sie wirtschaftlich lohnenswert, da Heiz- und Kühlkosten gesenkt werden und die Lebensdauer des Daches erhöht wird. Zum anderen bringt sie viele ökologische und soziale Vorteile mit sich. Laut des Naturschutzbunds Deutschland könnte eine konsistente Umsetzung von Dachbegrünung zwei Drittel aller versiegelten Flächen zurück an die Natur geben. Die Verpflichtung zur Dachbegrünung wirkt den Folgen entgegen, die der Klimawandel auf die Städte hat.
- Kühlere Stadt
In Städten kann es im Sommer bis zu sieben Grad wärmer werden als in der ländlichen Umgebung. Regenwasser, das nicht direkt abfließt, sondern auf Gründächern gespeichert und dort verdunstet, kühlt die darüberliegende Luft. Wenn Begrünung großflächig umgesetzt wird, können Lufttemperaturen um 0,2 bis 0,9 Grad gesenkt werden.
- Bessere Luft
Die Vegetation auf Dächern bindet Feinstaub und Schadstoffe. Sedumpflanzen, beispielsweise, nehmen bis zu zehn Gramm Feinstaub pro Quadratmeter im Jahr auf.
- Regenmanagement
Dachbegrünung speichert Regenwasser – rund 30 Liter pro Quadratmeter können bereits extensive Gründächer aufnehmen. Dies allein reduziert den Abfluss in die Kanalisation und entlastet sie bei Starkregenereignissen. Es mindert also das Überflutungsrisiko.
- Lebensraum für Kleintiere und Insekten
Durch die Versieglung von Grünflächen wird auch Tieren ihr Lebensraum genommen. Gründächer bieten einen Rückzugsort für unter anderem Vögel, Insekten, Bienen und Schmetterlinge.
Auch für Menschen kann intensive Dachbegrünung als Dachgärten und -parks neue Erholungsräume schaffen.
- Schutz von Dächern
Dachbegrünung schützt die Dachabdichtung vor UV Einstrahlung, Hagel oder auch Temperaturextremen.
- Besseres Raumklima
Dachabdeckungen können sich stark erhitzen: Während helle Kiesschichten Temperaturen bis zu 50 Grad Celsius erreichen, erwärmt sich schwarze Dachpappe auf bis zu 90 Grad Celsius. Da Gründächer allerdings nicht wärmer als 20 bis 25 Grad Celsius werden, schützen sie Räume vor Hitze im Sommer und halten die Wärme im Winter. Außerdem absorbieren sie Schall und reduzieren den Straßenlärm von draußen.
Gibt es Nachteile einer Dachbegrünung?
Die Vorteile von Gründächern lassen sich nicht abstreiten – doch Stimmen aus der Bauwirtschaft sind teilweise noch zwiegespalten. Während die Zahl der genehmigten Wohnungen immer mehr sinkt, befürchten einige Bauexpert:innen, dass eine Gründach-Pflicht Genehmigungsverfahren weiterhin verkomplizieren und verteuern würde. Die Nachteile eines Gründachs liegen vor allem in den Anschaffungskosten. Demnach würde eine Pflicht eine weitere Hürde für viele Investor:innen darstellen.
Folgende Aspekte müssen bei einer Dachbegrünung bedacht werden:
- Anschaffungskosten: In der Regel kostet eine extensive Dachbegrünung zwischen 50 und 70 Euro pro Quadratmeter. Hier unterscheiden sich die Preise, weil sie von verschiedenen Faktoren abhängen, wie der Substratdicke, der Installation oder auch der Größe des Dachs. Die Kosten für eine Kiesschicht hingegen betragen ungefähr 15 bis 50 Euro pro Quadratmeter. Wägen Sie dennoch Investitionskosten mit Sanierungskosten ab – auf Dauer sparen Gründächer Kosten ein.
- Erhöhtes Risiko von Feuchtigkeitsschäden: Wird die Dachabdichtung nicht fachgerecht „wurzelfest“ gemacht und leiten die Drainageschichten das Regenwasser nicht sicher ab, besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeitsschäden eintreten. Daher müssen Fachkräfte genaustens auf die Richtigkeit des Aufbaus eines Gründachs achten. So können zukünftige Pflegegänge auch optimal ausgeführt werden.
- Höherer Pflegeaufwand: Sowohl extensive als auch intensive Dachbegrünung muss regelmäßig gewartet werden. Wer die Pflege des Gründachs vernachlässigt, riskiert Fehlentwicklungen in der Vegetation, aber auch das Freilegen des Substrates und der Dachhaut. Gründächer müssen ein- bis zweimal im Jahr von Unkraut befreit werden, damit diese keine Schäden auf dem Dach verursachen. In Dürreperioden muss die Dachbegrünung gegebenenfalls bewässert oder gedüngt werden, um das Absterben der Pflanzen zu verhindern.
Gründach Förderungen: Wie lässt sich Dachbegrünung finanzieren?
Obwohl es keine bundesweite Verpflichtung zur Dachbegrünung gibt, lohnt es sich für Bauherr:innen dennoch ein Gründach in Erwägung zu ziehen. Denn auf bundesweiter sowie kommunaler Ebene gibt es einige Förderprogramme, die Gründächer finanzieren.
Staatliche Förderungen
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet zinsgünstige Darlehen sowie Zuschüsse. Dazu gehören beispielsweise der Kredit-Nr. 261, das KfW-Umweltprogramm oder das Umweltinnovationsprogramm. Diese fördern Dachbegrünung als Teil von Sanierungen zum Effizienzhaus oder anderen umweltfreundlichen Baumaßnahmen.
Kommunale Förderungen
Je nach Kommune unterscheiden sich die geförderten Beträge. So bieten regionale oder städtische Subventionen Zuschüsse von zehn bis 20 Euro pro Quadratmeter Begrünung oder Vergünstigungen bei Niederschlagswasser-Gebühren. Das Projekt „GRÜN hoch 3“ der Stadt Köln, beispielsweise, fördert pro Objekt bis zu maximal 20.000 Euro.
Die BuGG Städteumfrage von 2024 fasst in einer Übersicht zusammen, welche Städte Förderungen für Dachbegrünung anbieten. 56 von 197 recherchierten Städten mit über 50.000 Einwohnern bieten bereits Förderungen an.
Private Finanzierungsoptionen
Ebenso möglich sind private Finanzierungen, wie spezielle Kredite von Banken. Zudem gibt es auch Prämiennachlässe bei Versicherungen für Gebäude mit begrünten Dächern, da durch Gründächer das Risiko von Hitze- und Starkregenschäden verringert werden.
Solargründach-Pflicht: Wie lässt sich Photovoltaik mit Gründach kombinieren?
Die meisten Bundesländer haben für Neubauten und Dachsanierungen bereits eine Solarpflicht eingeführt, sowohl für Flachdächer als auch Dächer mit Neigung. Die Angaben variieren je nach Bundesland, doch Dächer ab bereits 50 Quadratmetern Fläche können hiervon betroffen sein.
Ab 2027 will die Stadt Hamburg einen Schritt weiter gehen: So soll für Neubauten und Dachsanierungen eine Solargründach-Pflicht eingeführt werden. Dabei sollen 70 Prozent des Daches begrünt werden und 30 Prozent mit Photovoltaik belegt werden.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag, sind PV-Anlagen und Grünflächen sehr gut vereinbar. Dadurch, dass das Dach durch die Dachbegrünung abgekühlt wird, steigt der Mehrertrag der PV-Anlage um vier bis sechs Prozent. Die Dachfläche wird somit dreifach genutzt: zur Stromerzeugung, zum Witterungsschutz und zum Klimaschutz.
Ob weitere Städte und Bundesländer ebenfalls auf eine Solargründach-Pflicht setzen werden, bleibt noch abzuwarten. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, werden klimaschonende Maßnahmen in Städten immer wichtiger – zukünftige Verpflichtungen zu Photovoltaik oder Gründächern lassen sich nicht ausschließen.
Fazit: Schwammstadt-Konzept als Zukunft des Städtebaus

Die Dachbegrünung ist nur eine von vielen Maßnahmen, mit denen Städte regensicher und klimaresilient gestaltet werden können. Ergänzt durch Fassadenbegrünung, mehr Grünflächen oder Regenrückhaltebecken entwickeln sich die ersten Städte zu sogenannten „Schwammstädten“. Wie Prof. Dr.-Ing. Theo Schmitt in seiner Studie zu Starkregenrisikomanagement betont: Das Schwammstadt-Prinzip zählt zu den wirksamsten Strategien gegen Überflutung, Hitze und Trockenheit in städtischen Räumen. Auch Landschaftsarchitekt Friedhelm Terfrüchte von der Architektenkammer NRW fordert, dass begrünte Dächer „selbstverständlich begrünt“ werden sollten. Denn trotz höherer Investitionskosten bieten sie langfristig spürbaren Hitzeschutz und verbessern das Stadtklima.
Ein gelungenes Beispiel ist das erste Green Roof Lab-Projekt in Berlin: Auf 212 Quadratmetern setzten 170 Hausbewohner:innen ein Gründach-Projekt um, das nicht nur ökologisch wertvoll ist – sondern auch zeigt, wie Dachbegrünung innovativ und sozial integrativ gestaltet werden kann. Mit Informationstafeln über den Entstehungsprozess und ökologisches Wissen dient das Gründach so als Lernort und Vorbild für Biodiversität und nachhaltige Stadtentwicklung.
Eine wichtige Aufgabe, denn wie der BuGG Marktreport für Gebäudebegrünung aufzeigt, wurden im Jahr 2023 nur 17 Prozent aller neu entstandenen Flachdachflächen begrünt. Wenn immer mehr Städte eine Gründach-Pflicht fordern und fördern würden, könnte dieser Anteil erheblich gesteigert werden.